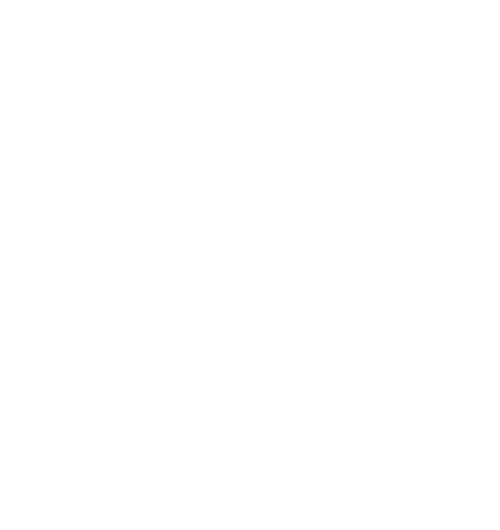Zur Theorie
Literaturempfehlungen
Zeitschrift des SAP Ausgabe 3
Zeitschrift des SAP Ausgabe 9
Zeitschrift des SAP Ausgabe 11
Zeitschrift des SAP Ausgabe 12a
Zeitschrift des SAP Ausgabe 12b
Zeitschrift des SAP Ausgabe 14a
Zeitschrift des SAP Ausgabe 14b
Zeitschrift des SAP Ausgabe 16
Zeitschrift des SAP Ausgabe 24
Zeitschrift des SAP Ausgabe 35
Zeitschrift des SAP Ausgabe 36
Zeitschrift des SAP Ausgabe 38
Zeitschrift des SAP Ausgabe 39
Zeitschrift des SAP Ausgabe 40
Zeitschrift des SAP Ausgabe 41
Zeitschrift des SAP Ausgabe 42
Peter von Matt:
Verkommene Söhne, missratene Töchter. Familiendesaster in der Literatur. Carl Hanser München Wien 1995
Das Schicksal der Phantasie. Studien zur deutschen Literatur. Dtv 1994
Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur. Dtv 1991
Ich lese gerade Bücher des Schweizer Literaturwissenschaftlers Peter von Matt. – Ein Genuss! Der seltene Fall, dass jemand klug und unangestrengt weite Gedankenbögen entwickeln und sie in prägnanter, oft auch witziger Sprache darstellen kann. Und viel Psychoanalytisches drin, in neuen, unverbrauchten Sprachbildern.
Ich komme nicht dazu, so etwas wie eine Rezension zu verfassen, will aber ein paar Stellen abschreiben, die mir besonders gefallen haben, – auch wenn sie dann aus dem Zusammenhang gerissen dastehen. Vielleicht ist doch etwas von den unerschrockenen, lustvollen Denkbewegungen spürbar, die man beim Lesen der Bücher (ebenso lustvoll) nachvollziehen kann.
(aus: ”Phantasie”, s.u.., S.204:)
“Der Prozess der Zivilisation ist einer des schrittweisen, subtil kalkulierten Verbots, aber kein Verbotenes verschwindet. Verbot ist Verwandlung. Das Ausgewiesene steht in andern Kleidern wieder da, das Zottige kehrt frisiert zurück, der alte Schwefel weht als Parfüm durch die gepflegten Räume. Sitten und Sittlichkeit sind historisch so beweglich wie die Hüte und die Speisekarten. Der Code des gesellschaftlichen Anstands ist zugleich eine Last und eine Entlastung, er macht uns frei in dem Maße, in dem er uns unterdrückt. Der Stein, der vom Herzen fällt, liegt schwer auf dem Magen. (..)”
(aus: ”Phantasie”, mit Beiträgen über Nestroy, Th.Mann, Kafka, George, Brecht, u.v.a.; hier ein längerer Abschnitt über Eichendorff, S.116f.:)
“(..) Warum aber kehrt sich das Ich, das in der Dichtung Eichendorffs laut wird, von dem Ort, nach dem es gestrebt hat, doch immer wieder ab? Warum repetiert sich in der poetischen Produktion beides: die Apostasie vom Vatergott und Apostasie von der Muttergottheit? Die Antwort ist einfach: Es gibt hier wie dort nichts zu tun. Da ist einerseits der betende Einsiedler mit dem Blick auf das Kreuz und das Himmelstor, und da ist andererseits der irrende Ekstatiker der Klänge und Abgründe mit dem plötzlichen Blick auf den nackten Leib der schönen Frau – und beide können zwar immer inbrünstiger werden auf ihre je andere Weise, aber darüber hinaus haben sie nichts zu tun. Was fehlt, was ganz und gar mangelt, ist hier wie dort die Tat, das Wirken, das folgenreiche Verändern der Welt durch Arbeit in der Geschichte und an der Geschichte. (…)
Das fromme Warten und das erotische Irren, die zwei fundamentalen Befindlichkeiten des Subjekts in Eichendorffs Gedicht, beinhalten beide die gleiche Handlungslähmung gegenüber der gesellschaftlichen Welt. Der Einsiedler legt seinen Garten an, die getaufte Gegenform zu Wildnis, aber davon nährt sich höchstens er selbst. Der Irrende wird vielleicht ein Jäger, aber ein Jäger ohne Beute, der keinem Hungrigen den Magen füllt oder je zu füllen gedenkt. Deshalb muss immer wieder aufgebrochen werden, immer neu muss von der einen Seite abgefallen und zur andern hin ausgezogen werden. Denn im Aufbruch, nur noch in ihm allein, steckt das Phantom der Tat. (..) Wer bei Eichendorff aufbricht, bricht nicht zur Tat auf, aber er bricht auf, als ob er zur Tat aufbräche, und aus allen Poren lodert ihm die einstige Lust zur Weltarbeit, von der er doch nichts mehr weiß.
Jetzt erklärt sich, warum die Ziellosigkeit Ziel sein kann. Der Aufbruch in die Ziellosigkeit und die ziellose Bewegung selbst vollziehen einen Gestus, körperlich, rituell, der einst auf reale Horizonte gerichtet war, auf die Neueinrichtung der Welt in Freiheit und Liebe, auf das deutsche Paradies hier und jetzt. Das Ritual des Auszugs feiert das Andenken an das verschollene Projekt der großen Weltveränderung. Die Trance von Freiheit und Liebe, die einst dazugehörte, wird unbegriffen noch einmal verspürt vom fahrenden, reisenden, irrenden Leib.
Dem entspricht nun beweiskräftig die Tat-sache, dass es kein vorbildhaftes Liebespaar mehr geben kann in Eichendorffs Gedicht. Das Paar als die zentrale Präfiguration einer befreiten Gemeinschaft ist aus der lyrischen Rede verschwunden. Dem entspricht des weiteren die schroffe Abkehr vom Kind als der verkörperten Zukunft, der leibhaftigen, lauthals sich selbst verkündenden, fröhlich zappelnden Zukunft. (..)”
(aus: ”Liebesverrat”, S.26:)
“In den Ereignissen der Hochzeit, des Mordes und des Wahnsinns als abschließenden, bereinigenden Vorgängen, als Abläufen der Welt-Einrichtung, verdichten sich szenisch-konkret die Grundmöglichkeiten der menschlichen Sozialisation, jenes jahrelangen Prozesses, in dem das Individuum zu dem wird, was man ‘Glied der menschlichen Gesellschaft nennt’. Dieser Prozess wird erlitten. Er kann scheitern, sichtbar oder unsichtbar, unsichtbar vielleicht bei allen äußeren Anzeichen eines erfolgreichen Abschlusses. Die bisher prägnanteste Theorie, was den dramatischen Kern dieses Prozesses betrifft, ist die Lehre von der ödipalen Krise, wie sie Freud entwickelt und erläutert hat. Zu dieser Lehre gehörten von Anfang an die vielfältigen Formen, in denen sie bestritten wurde und wird. Es gibt, durchaus andauernd, den reaktionären Versuch der völligen Beseitigung durch Deklarationen der Ungültigkeit oder durch konsequentes Ignorieren. (…)
Wer dann in späteren Jahren ein Buch liest, eine Geschichte hört, ein Theaterstück anschaut, spielt dabei immer, ungewollt und unausweichlich, etwas von jenem seinem ersten und ganz eigenen Drama wieder durch. Was er im Erlebnis der Literatur erhofft und fürchtet, was ihn dabei begeistert und entsetzt, weinen und lachen lässt, er kennt es alles schon mit Zwerchfell, Herz und Nieren, weil er selbst einmal Protagonist war auf Tod und Leben.
Die drei letzten, nicht mehr weiter reduzierbaren Themen der Literatur sind die szenischen Verkörperungen der drei möglichen Ausgänge aus dem Konflikt der frühkindlichen Sozialisation, welcher mit dem großen Vergessen um das fünfte Lebensjahr herum beendet wird, dem ersten Vorhang nach dem ersten Stück.”
Aus dem Buch ”Verkommene Söhne, missratene Töchter” etwas auszuwählen fällt mir schwer, weil ich es als Ganzes so gescheit und spannend finde. (Was Peter von Matt z.B. über weibliche Sozialisation schreibt, im Abschnitt über die Droste. Oder der Abschnitt über Kafka, der gut auf unser Symposium gepasst hätte; der fällt mir manchmal in Analysen mit jungen Männern ein, macht mich vielleicht auch hellhöriger für manche Aspekte der ”Schwellen-existenz”.)
Christian Schacht
Else Pappenheim:
Hölderlin, Feuchtersleben, Freud. Beiträge zur Geschichte der Psychoanalyse, der Psychiatrie und Neurologie.
Herausgegen und eingeleitet von Bernhard Handlbauer.
Bibliothek Sozialwissenschaftlicher Emigranten, Band VII.
Verlag Nausner & Nausner, Graz.
606 Seiten
Else Pappenheim wurde 1911 in Salzburg geboren, wuchs in Wien auf und besuchte die „Schwarzwaldschule“, eines der ersten Mädchengymnasien in Wien. Dort lernte sie u.a. Marie Langer und Cornelia (Nelly) Adler, die jüngste Tochter Alfred Adlers, kennen. Aline Furtmüller, sozialdemokratische Gemeinderatsabgeordnete und Frau des Individualpsychologen und Schulreformers Karl Furtmüller war ihre Lieblingslehrerin. Unter ihrem Einfluss schrieb sie eine Maturaarbeit über Friedrich Hölderlin. Else Pappenheim studierte von 1929-1935 Medizin, arbeitete anschließend als Sekundarärztin an der neurologisch-psychiatrischen Klinik unter Prof. Otto Pötzl und begann eine Ausbildung am Wiener Psychoanalytischen Institut.
Nach Hitlers Einmarsch wurde sie entlassen. Sie emigrierte im November 1938 in die USA und arbeitete zunächst bei Prof. Adolf Meyer an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. 1941 übersiedelte sie nach New York, wo sie noch heute lebt. Bis zu ihrer Pensionierung unterrichtete sie an verschiedenen Universitäten und arbeitete als Neuropsychiaterin und Psychoanalytikerin an mehreren Krankenhäusern und in freier Praxis.
Obwohl der „Anschluss“ Österreichs ihre Karriere an der Wiener Klinik beendete und zur leidvollen Erfahrung der Emigration führte, hat sich Else Pappenheim die Liebe zu Wien bewahrt. Viele ihrer Arbeiten nehmen Bezug auf die österreichische Kultur-, Medizin- und Zeitgeschichte und auf ihre vielseitige intellektuelle Prägung im Wien der Zwischenkriegszeit.
In diesem VII. Band der „Bibliothek Sozialwissenschaftlicher Emigranten“ werden die wissenschaftlichen Arbeiten Else Pappenheims vorgestellt, die in Österreich wenig bekannt sind. Zwei Drittel der Schriften, die aus den Jahren 1929-1995 entstanden sind, wurden noch nie oder nur auf Englisch publiziert.
Sie beinhalten Erinnerungen an die neuropsychiatrische und psychoanalytische Ausbildung in Wien, an die Wiener Sekundararztzeit, an Stationen der Emigration (Palästina, Baltimore, New Haven, New York), an prominente Psychiater und Psychoanalytiker (darunter Annie Reich, Judith Kestenberg, Heinz Hartmann, Ernst Kris, Marie Langer und Eduard Kronold) und geben Aufschlüsse über die Entwicklung der Psychoanalyse in den USA unter dem Einfluss von europäischen Emigranten.
Den Schwerpunkt bildet die Geschichte der Wiener Schule der Medizin und der Psychoanalyse: Ernst Freiherr von Feuchtersleben, ein weitgehend vergessener Psychiater und Universitätsreformer des Wiener Vormärz, zugleich ein Vorläufer der modernen Seelenheilkunde; Wilhelm von Mauthner und die Entstehung der Kinderheilkunde in Wien; die Geschichte der von Theodor Meynert geprägten Diagnose der „Amentia“; die Revision der Hysterie-Diagnose von Freuds Patientin Emmy v.N. zugunsten eines neurologischen Syndroms.
Weitere Beiträge gehen der Frage nach, warum die Psychoanalyse in Wien entstanden ist, stellen Verbindungen zwischen der österreichischen Zeit- und Wissenschaftsgeschichte her und befassen sich mit der Geschichte der Psychoanalyse in den USA und in der Sowjetunion.
Die klinischen Beiträge beinhalten eine Pathographie des Dichters Friedrich Hölderlin. Dessen schizophrene Erkrankung stand am Beginn von Else Pappenheims Interesse für Psychiatrie und Neurologie. In einer Arbeit über einen schizophrenen Architekten, die 1938 gemeinsam mit Ernst Kris in Wien begonnen und erst in New York vollendet wurde, kommt das inzwischen geläufige Thema „Kunst und Geisteskrankheit“ zur Sprache. Zusammenfassungen von neuropsychiatrischen Arbeiten aus den Jahren 1935-1938, Schriften zur kindlichen Trennungsangst und über Studentenberatung, sowie eine neurologische Studie zu einem tödlichen Stromunfall runden den klinischen Teil des Buches ab.
In seiner biographischen Einleitung rekonstruiert der Herausgeber einzelne Stationen des Lebens von Else Pappenheim, z.B. Erinnerungen an den I. Weltkrieg, an die „Schwarzwaldschule“, an Begegnungen während des Studiums, an die Klinik Pötzl und an ihre psychoanalytische Ausbildung in Wien. Vieles davon ist im Sinne einer Zeitzeugenschaft für die österreichische Medizin- und Wissenschaftsgeschichte von großem Interesse.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Else Pappenheims Begegnungen an psychoanalytischen Instituten in den USA. Wie Mosaiksteine geben sie Aufschlüsse über Persönlichkeit und Wirken zahlreicher emigrierter Wiener Psychoanalytiker, aber auch Antworten auf Fragen der „Amerikanisierung“ der Psychoanalyse.
Die individuelle Lebensgeschichte Else Pappenheims wird so vom Herausgeber durch eine Emigrationsgeschichte der Wiener Psychoanalyse und ihres Einflusses in den Vereinigten Staaten ergänzt und in den Kontext der Wirkungsgeschichte österreichischer Wissenschaftsemigration gestellt..
Bernhard Handlbauer
„Ich habe Wien sehr geliebt!“
–
Else Pappenheim im Interview mit Bernhard Handlbauer
Über Berta Bornstein
Sie war schon vor mir in New York, wir haben im selben Haus gewohnt. Ich habe sie früher auch nicht gekannt, nicht einmal etwas von ihr gewusst. Ich glaube, sie kam aus Prag. Da waren zwei Schwestern: Steffi und Berta Bornstein. Beide waren sie Kinderanalytikerinnen, die in Berlin ausgebildet wurden. Gesprochen hat sie wie eine Österreicherin, aber viele Prager haben so gesprochen, das besagt gar nichts. Sie haben wohl in Wien gelebt, denn Edith Jackson hat da diesen Kindergarten eingerichtet und war mit den beiden Bornsteins zusammen. Geschrieben hat sie nicht viel, vielleicht nur ein oder zwei Arbeiten, die aber sehr gut sind. Eine über ein zweijähriges Kind, scheint mir ein „classic“ zu sein. Sie war eine besonders warme und nette Frau. Sie war sehr gut mit Otto Fenichel. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie ihn sogar sehr geliebt hat. Er ist dann ein, zwei Mal nach New York gekommen, und sie hat ihm zu Ehren die ganze Gemeinde eingeladen. Sie war natürlich sehr gut mit Anna Freud und auch mit Annie Reich. Judith Kestenberg sagt, Berta Bornstein und Marianne Kris haben die Kinderanalyse hier eingeführt.
Über Charlotte Bühler
Sie war mir sehr unsympathisch, das ist alles was ich sagen kann. Pötzl hat sie eingeladen. Sie erschien im Abendkleid, was schon sehr sonderbar war. Und er (Karl Bühler) hat irgendwie so etwas Kriecherisches gehabt, während sie sehr arrogant war. Dann haben einige von ihren Studentinnen bei uns hospitiert. In Wien haben wir uns damals überhaupt nicht geschminkt, und die meisten der Patienten waren auch viel zu arm; die wären froh gewesen, wenn sie etwas zu essen gehabt hätten. Diese Studentinnen kamen aber stark geschminkt und hergerichtet daher. Sie wurden sehr verächtlich „die Bühler Girls“ genannt, von den Revuen her, und schließlich haben dann einige von uns Sekundarärzten gesagt: „Wenn ihr hier arbeiten wollt, dann richtet euch nicht so her. Unsere Patienten haben oft nicht genug zu essen, die können sich keine Lippenstifte kaufen, entweder oder.“ Sie sind dann nicht mehr gekommen. Aber wir haben dieses ganze psychologische Institut verachtet. Ich glaube, weil sie so preußisch war.
Über Ernst Federn
Ernst Federn ist an und für sich ein lieber Kerl. (BH: Er ist sehr stark mit seinem Vater identifiziert.) Jetzt; früher hat er das nie gehabt. Ich finde das irgendwie traurig, dass sein Lebenszweck heute darin besteht, seinen Vater zu verteidigen und berühmt zu machen, denn als Mensch war er mir immer sympathischer als sein Vater. Was mir an ihm wirklich imponiert: Der Mann war sieben Jahre im Konzentrationslager und ist trotzdem anständig geblieben. Er ist nicht einmal sehr meschugge kann man sagen. Er macht eigentlich einen sehr gut adjustierten Eindruck. Er hat eine besonders liebe Frau und hat trotz allem zustande gebracht, nicht nur ein normales Leben zu führen, sondern sogar sehr engagiert mit Gefangenen in Stein zu arbeiten. Das imponiert mir. Er ist wirklich ein hochanständiger Mensch, das war der Vater vielleicht auch, aber er ist kein Tyrann, wie der Vater, der ein absoluter Diktatortyp war – und sehr ambivalent. Das ist Ernst Federn nicht. Er ist von Kreisky eingeladen zurückgekommen, ist wirklich ein Idealist in vieler Beziehung und ein Optimist. Ich habe ihn gefragt, ob es in Österreich wirklich so schlimm ist und er hat gesagt, „aber nein, es sei ja alles nicht so arg“ – die Gemeinde und die Regierung täten sehr viel gegen den Antisemitismus. Er, der ein wirkliches Opfer war, sagt das. Ich muss sagen, es imponiert mir, dass jemand so – nicht nur anständig, sondern – gut bleiben kann und nicht bösartig geworden ist. Das ist schon allerhand, dass einer das überlebt und trotzdem noch an die Menschheit glaubt. Das bewundere ich.
Über Marie Langer
Unsere Freundschaft war immer entweder sehr intensiv, oder sie war anderweitig sehr engagiert. Wir waren vier, die immer zusammen gelernt haben, aber sie war nicht immer dabei. Manchmal sind wir Tag und Nacht zusammengesessen und haben miteinander gelacht, und dann wieder war sie plötzlich verschwunden. Und dann ist sie ja nach Spanien. (1)
So sehr ich Mimi gerne gehabt habe – sie war eigentlich meine beste Freundin –, aber ihr Kommunismus hat mich zu sehr an meine Tante „Mizzi“ erinnert. Die waren beide so, wie soll ich sagen … Das war ein Glaube für sie, das war keine rein politische Überzeugung, sondern eine Religion. Und sie waren derartig fanatisch und auch unvorsichtig, dass man fast ein bisschen Angst bekommen hat. (5)
Über Paul Schilder
Paul Schilder hat in Wien eine enorme Rolle gespielt. Er war ja schon vor 1938 weggegangen, aber er ist immer noch (eine Art) Gott gewesen für die Wiener Klinik. Er war sozusagen das größte Genie. Schilder war wahrscheinlich außerordentlicher Professor. Lehrkanzel hatte er keine, aber eine Abteilung im Bellevue-Spital. Er war der erste der mit seiner Frau zusammen mehr oder weniger Jugendpsychiatrieanalyse eingeführt hat, Gruppentherapie für Jugendliche. Er war sicherlich ein ebensolches Genie wie Freud. Sein tragischer früher Tod war wirklich ein furchtbarer Verlust für die Medizin, die Analyse und die Psychiatrie. Er ist überfahren worden. Er war ein äußerst zerstreuter Mensch und er ist vom Spital gekommen, wo seine Frau das dritte Kind geboren hatte. Er hat irgendwie nicht aufgepasst, ist über die Straße gegangen und von einem Lastwagen überfahren worden. Ich meine, warum macht man daraus einen Selbstmord (wie manche Analytiker es taten)? Er war einfach so der typische zerstreute Herr Professor. Er ist ja von seinem neuen Kind gekommen, die Straßenbeleuchtung war schlecht. Es ist tragisch, er war erst um die Vierzig.
Seine Bücher waren auch so wunderbar, wirklich schön geschrieben. […] Und er hatte sehr großen Einfluss. Durch ihn sind Judith Kestenberg, Stengel und ich weiß nicht, wer noch, hergekommen.
In der analytischen Gesellschaft hier hatte Schilder keinen großen Einfluss. Er ist seine eigenen Wege gegangen, hat seine eigenen Ideen gehabt.
Über René Spitz
Er war sicher ein sehr kluger Mensch, aber, so glaube ich, mehr von sich eingenommen als berechtigt war. Er war auch ganz gut mit all den Analytikern. Ich glaube, da hat sich ein jeder ein kleines bisschen über ihn lustig gemacht, weil er so pompös und von sich eingenommen war. Er war ein großer Mensch, sprach sehr gut, aber ein bisschen theatralisch würde ich sagen. Er hat wunderbar Geschichten erzählt. Ich habe immer ein bisschen Bedenken gehabt, ob das wirklich alles genau so ist. Er war ein richtiger Ungar, lebhaft, feurig. (3)
Über amerikanische Analytiker und die Psychoanalyse in den USA
Was der Analyse hier geschehen ist, ist ja unmöglich. Diese absolute Starre. Ich habe nie einen europäischen Analytiker gekannt, der so starr war. Man darf dem Patienten nicht die Hand geben, ihn nicht fragen „Wie geht es Ihnen?“ Wenn er krank war, durfte man nichts sagen, nicht einmal „Es tut mir leid“, wenn jemand gestorben ist, auch nicht „Ich wünsche Ihnen alles gute für die Prüfung“ oder vielleicht sogar zum Geburtstag, sondern man sitzt da wie ein Steinblock hinter dem Patienten. So viele sind deshalb dazugekommen, weil sie als Analytiker vollkommen isoliert und beschützt hinter der Couch sitzen können.
Die, die ich gekannt habe, waren irgendwie verrannt, besonders engherzig, irgendwie mit Scheuklappen. Sie waren so besonders auf das strikte Protokoll aus, dass man weder geantwortet noch gefragt hat. Bei den wenigen, die ich besser gekannt habe, hatte man den Eindruck, dass sie besonders zwangsneurotisch waren. Das war eine Art Abwehr, ihre eigene Ungelockertheit. Aber ich habe nicht allzu viele gekannt. Unter den Jüngeren ist es nicht ganz so, z.B. ist Jeffrey viel menschlicher und lockerer. Diejenigen, die jetzt etwa vierzig, fünfzig Jahre alt sind, sind auch wieder ganz anders, – viel menschlicher. Aber die erste Gruppe, war besonders verrannt. Die waren etwa in meinem Alter.
Über falsche Versprechungen und den Niedergang der Psychoanalyse
Es gab zu viele Leute für die Analyse, Ärzte und Laien, für die zu wenig Patienten da waren. Irgendwie waren die Erwartungen übertrieben. Überhaupt: Alles geht schneller und schneller, und es kommen neue Sachen dazu.
Freud hat immer nur gesagt, die Psychoanalyse könne das neurotische Unglück in ein allgemeines umwandeln. Er war also kein Optimist. Das größte Malheur hier in Bezug auf die Analyse war, dass sie sofort das Allheilmittel, die Erlösung sein sollte – das war Wahnsinn. Natürlich wurde nicht eingehalten, was man den Leuten versprochen hat.
Über Heldentum
Ich weiß nicht, ob ich damals eine Heldin gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich gewagt hätte, etwas zu sagen. Ich glaube nicht, dass ich jemanden hätte umbringen können oder jemanden foltern schon gar nicht, lieber hätte ich mich selber umgebracht. Aber ob ich den Mut gehabt hätte, etwas zu sagen, weiß ich nicht. Es ist schwer. Man kann nicht jeden verdammen, der nichts gesagt hat. Ich glaube nur, irgendwo gibt es doch eine Grenze. Aber ich könnte auch im Krieg niemanden umbringen. Ich sage immer, ich bin froh, dass mein Vater Arzt war, ich weiß er hat im ersten Weltkrieg niemanden umgebracht.
Über den Optimismus der Amerikaner
Dieser unverwüstliche Optimismus. Heute haben viele Angst vor der Technik, aber in den ersten Jahren hat es wirklich so ausgesehen, dass man alles technisch lösen könne. Die Amerikaner haben mehr erreicht als alle anderen, und sie haben mehr Grund zum Optimismus. Man kann alles reparieren, den Menschen mit eingeschlossen und die menschliche Seele. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, lässt man es fallen und tut etwas anderes.
Über Wien
Ich habe Wien sehr geliebt, wissen Sie. Das hat nicht einmal etwas mit den Menschen zu tun, es gibt genug unsympathische Wiener, aber die Stadt. Die meisten Wiener haben das im Übrigen. Ich habe noch nie Leute aus anderen Städten gefunden, die das haben, diese Sehnsucht nach der Stadt. Viele von meinen Bekannten sagen, das ist irgendwie die Luft, die Beleuchtung, die Häuser, die Straßen, die Menschen nicht. Ich habe auch die Sprache gern, obwohl viele sagen, Wienerisch sei so hässlich. Es ist irgendetwas in der Luft, wenn man in Wien lebt. Das habe ich schon als Kind gehabt – ich bin nicht gern aufs Land gefahren. Besonders ist mir das aufgefallen, als ich mit mehreren Berlinern gesprochen habe. Das hören Sie nie. Die einzige, die das beschreibt, ist die Mascha Kalecko. Die ist die einzige, die von Berlin schreibt, wie die Wiener von Wien sprechen.
Nadine Hauer: „Hans Strotzka. Eine Biographie“
(Verlag Holzhausen, Wien 2000)
Es handelt sich m.E. um den Glücksfall einer differenzierten, kritischen Biographie.
In der Einleitung beschreibt die ehemalige ORF-Journalistin Nadine Hauer, wie sie im Juni 1994 im Radio vom Tod Strotzkas erfuhr, der bei einem Brand in der Küche des Pflegeheims ums Leben kam, in dem er damals gewohnt hatte: „..Ich denke an die Gespräche mit ihm in den letzten Wochen und daran, dass er bei meinem letzten Besuch Ende Mai geweint hat und dass mich der Grund für diese Tränen sehr irritiert hatte. Kurz darauf war mein Entschluss gefasst: Ich wollte eine Biographie über diesen Mann schreiben, dessen Leben nicht nur ein Stück österreichischer Zeitgeschichte und der Geschichte des Umgangs mit dieser Zeitgeschichte repräsentierte, sondern darüber hinaus auch ein Spiegel für den Stellenwert von Psychoanalyse und Psychotherapie, für die Gesundheits- und Universitätspolitik und für wichtige gesellschaftliche Entwicklungen in der Zweiten Republik war.“ (Seite VII)
Zu Beginn der Lektüre war ich zeitweise irritiert, – wohl vor allem deshalb, weil meine Idealisierung Strotzkas gestört wurde. (Ich habe zu Beginn meines Studiums in Wien seine Vorlesungen besucht und ihn in der Folge in die – nicht gerade überfüllte – Schublade der „guten Väter“ gesteckt. Erst später hatte ich dann Gerüchte über seine NS-Vergangenheit gehört.) Meine Irritation hat sich in zunehmendes Interesse für ihn und seine Widersprüche und in großen Respekt vor der Autorin verwandelt. –
Einen Bezug des Buches zum SAP will ich auch erwähnen: In der Einleitung beschreibt Hauer, dass sie Strotzkas Texte und die Gespräche über ihn “….wie eine Hochschaubahn erlebt (hat), auf der mich Dr. Klaus Bengesser in Salzburg als Supervisor begleitet hat.“ (Seite IX)
Ich zitiere noch den Schlussabsatz: „In meinem stetigen Wechselbad der Gedanken und Gefühle habe ich schließlich mit Hans Strotzka meinen Frieden gemacht. So wie er selbst habe auch ich meine Ambivalenzen ihm gegenüber nicht aufgelöst, aber ich habe auch immer wieder das Bild des weinenden alten Mannes im Pflegeheim vor mir, der seine Familie schlecht behandelte und wahrscheinlich viele Menschen enttäuschte, vor allem aber sich selbst sein Leben lang mit seiner Ambivalenz gequält hat.“ (S.289)
– Ein überaus gescheites, klares und berührendes Buch.
Christian Schacht
Hans-Jürgen Möller, Norbert Müller (Hg.): Schizophrenie. Langzeitverlauf und Langzeittherapie. Springer Verlag: Wien New York. 2004.
ISBN: 3-211-40482-1.
Das vorliegende Buch fasst jene Vorträge zusammen, die anlässlich des „2. Münchner Kraepelin-Symposiums“ gehalten wurden. Führende deutschsprachige Forscher befassen sich mit biologisch-psychiatrischen Themen zur Schizophrenie.
Im Kapitel „Diagnostik und Verlauf“ wird der Einfluss des Diagnosezeitpunktes und Behandlungsbeginns auf Therapieerfolg und Verlauf beschrieben. Eine lange Dauer der unbehandelten Psychose (DUP) korreliert mit signifikant stärker ausgeprägter Minussymptomatik und kognitiven Störungen, häufigerer Rehospitalisierung, langsamer einsetzendem Therapieerfolg und niedrigerem psychosozialen Funktionsniveau. Insgesamt ist daher von einer früh einsetzenden Diagnose und Therapie ein günstiger Effekt auch auf den Langzeitverlauf zu erwarten. Ein sehr früher Behandlungsbeginn, bestmöglich in der Prodromalphase, müsste sich daher vermindernd auf den Chronifizierungsanteil, der bei schizophrenen Menschen mit 57 % angegeben wird, auswirken.
Im Kapitel „Biologische Aspekte des Langzeitverlaufes der Schizophrenie“ werden neueste Erkenntnisse der Genetik, der Immunologie, der Bildgebung und Neurophysiologie dargestellt, wobei ein sehr interessanter Beitrag die Analyse von Hirnstrukturen durch deformationsbasierte Morphometrie primär durch MRT gewonnener Bilder ist. Mit diesem neuen Verfahren können mit hoher Sensitivität und Reliabilität hirnstrukturelle Veränderungen auch bei schizophrenen Menschen abgebildet werden.
Das Kapitel „Langzeittherapie der Schizophrenie“ hat die Darstellung einzelner Projekte und Studien zum Inhalt, die sich schwerpunktmäßig mit Fragen der medikamentösen Langzeitprophylaxe und verschiedener Therapieansätze bei chronisch Kranken (Stichworte: bewältigungsorientierte Therapie, stationäre Krisenintervention, Angehörigenarbeit) befassen. Eine Studie, in der schizophrene Patienten nicht nur antipsychotisch, sondern zusätzlich antiinflammatorisch mit Celecoxib behandelt wurden, lässt die immer wiederkehrende Hypothese der Entzündung als pathogenetischen Faktor bei der Schizophrenie aufleben.
Insgesamt ein sehr anspruchsvolles Buch mit einem dem Vorbild Emil Kraepelin entsprechenden, stark biologisch-psychiatrischen Ansatz.
OA. Mag. Dr. Herwig Oberlerchner
Eckhardt-Henn Annegret / Hoffmann Sven Olaf: Dissoziative Bewusstseinsstörungen. Theorie, Symptomatik, Therapie. Schattauer Verlag: Stuttgart, New York. 2004. 496 Seiten, 21 Abb., 25 Tab.
ISBN: 3-7945-2203-6
Das vorliegende Buch gibt einen sehr guten und umfangreichen Überblick über den aktuellen Stand von Theorie, Klinik und Therapie dissoziativer Bewusstseinsstörungen, Erkrankungen, die erst in den letzten Jahren wieder zunehmend Beachtung finden und insbesondere seit dem Zerfall des Hysteriekonzeptes einer dringend neuen Konzeption und Gliederung bedürfen. Die Geschichte der Begriffsentwicklung, die Definition der Dissoziation als Abwehr- und Bewältigungsmechanismus bei hochkonflikthaften oder traumatischen Erlebnissen, die Abgrenzung gegenüber der Konversion und Somatisierung sowie neurobiologische Grundlagen dieser „Bewusstseinsspaltung“ werden in den ersten Kapiteln behandelt, bevor die verschiedenen Erscheinungsformen dissoziativer Störungen bereichert durch ansprechende Fallbeispiele und gegliedert nach der Reihenfolge im ICD-10 besprochen werden.
Es wird nicht verschwiegen, wie umstritten diese Erkrankungsbilder in der medizinischen, psychologisch-psychotherapeutischen Fachwelt noch sind, kontroversen Standpunkten, Definitionen und Diskussionen wird breiter Raum gegeben, zum Beispiel der Kontroverse Konflikttheorie versus Traumatheorie, die multiple Persönlichkeitsstörung als Ausdruck schwerster Traumatisierung zu sehen oder als durch Psychotherapeuten induziertes „false memory syndrom“ oder die zum Teil widersprüchlichen Konzeptionen und Klassifikationen in den gängigen Diagnoseschemata ICD und DSM.
Das Buch wird jeder Wissbegier zum Thema gerecht, geschichtliche Rückblicke werden ebenso geboten wie biologische Erklärungsmodelle oder psychodynamische Modelle, was wohl auch mit den Spezialgebieten der 26 namhaften Autoren zusammenhängen mag. Obwohl ein Reader ist das Buch ein in sich geschlossenes Werk, angenehm zu lesen, gefällig gegliedert, insgesamt sehr zu empfehlen, wie überhaupt die Schattauer-Bücher durch hohe Aktualität und Qualität auffallen.
Besonders hervorzuheben ist, dass es meines Erachtens sehr gut gelungen ist, psychodynamische (psychoanalytische) und (biologisch-) psychiatrische Aspekte anzunähern.
OA. Mag. Dr. Herwig Oberlerchner
Heinz Katschnig, Gerda M. Saletu-Zyhlarz (Hg.): Schlafen und Träumen.
Facultas Verlag: Wien. 2004. ISBN 3-85076-671-3.
Im Mai 2003 fand in Wien das 14. State of the Art Symposium unter dem Titel „Schlafen und Träumen“ statt, der vorliegende Reader fasst die dort gelieferten Beiträge zusammen. Das Buch widmet sich jenen beiden so wichtigen und erst in Ansätzen erforschten Anteilen unseres Lebens, immerhin verbringen wir ein Drittel unseres Lebens im Schlaf, ein Fünftel träumend. Es werden die physiologischen Abläufe gesunden Schlafes dargestellt, Schlafstörungen, deren Diagnose (Stichwort: Polysomnographie) und Behandlung (medikamentöse wie nichtmedikamentöse) diskutiert. Spannende Aussagen zum Thema „Schlafassoziierte Gedächtnisbildung“ stellen den Höhepunkt des Buches dar. Wer sich für Traumtheorien und Traumdeutung interessiert, wird mit diesem komprimierten aber durchwegs gut lesbaren Buch lehrreich bedient. Hypnos, der Bruder des Todes (Thanatos) hatte drei Söhne, erzählt Katschnig im ersten Kapitel, in dem er zu Literatur, Philosophie und Mythologie über Schlaf und Traum assoziiert: Morpheus, zuständig für menschliche Traumgestalten, Phobetos, für tierische Gestalten und Phantastos, der konnte leblose Dinge und Landschaften erzeugen. Diese Brüder helfen uns bei der Aufarbeitung von Alltagserlebnissen und vermehren unser kreatives Problemlösungspotential. Ein gelungenes Buch, sehr zu empfehlen.
OA. Mag. Dr. Herwig Oberlerchner
Gerhardt Nissen: Kulturgeschichte seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen.
Klett Cotta: Stuttgart. 2005. ISBN 3-608 94104-5.
Gerhardt Nissen, emeritierter Direktor der bayrischen Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Würzburg und Autor zahlreicher Veröffentlichungen auf diesem Gebiet bietet uns im vorliegenden Werk einen umfangreichen historischen Überblick über die Geschichte der seelischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Beginnend mit den Vorstellungen von psychischen Erkrankungen in der Antike spannt Nissen einen breiten, kurzweilig lesbaren und interessanten Bogen über den gesellschaftlichen Umgang mit dem Phänomen psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen im Mittelalter und der Aufklärung bis hin zur langsamen Etablierung und Emanzipation einer eigenständigen, primär pädagogischen später psychiatrischen und psychotherapeutischen Disziplin, wenn er sich auch ab dem 19. Jahrhundert nicht zuletzt aufgrund der Fülle des Materials, wie der Autor im Vorwort erwähnt, auf den deutschsprachigen Raum beschränken muss. Nissen stellt Protagonisten und Impulsgeber der jeweiligen Epochen vor, bringt Fallbeispiele und endet schließlich mit der Darstellung moderner psychotherapeutischer Behandlungsansätze.
Die Kulturgeschichte der seelischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ist eine Geschichte von Pflege und Vernachlässigung, ein emotional aufrüttelndes Neben- und Hintereinander von Toleranz und Tötung, Fürsorge und Euthanasie, auch ein Ringen um Einordnen des nicht Verstandenen und Bedrohlichen.
Ein bedrückendes, gleichzeitig informatives, stellenweise etwas zu lexikalisch wirkendes Buch.
OA. Mag. Dr. Herwig Oberlerchner
Katschnig Heinz, Amering Michaela (Hg.): Stimmenhören. Medizinische, psychologische und anthropologische Aspekte.
Facultas Verlag. 2005.ISBN 3-85076-638-1
Am 11.Jänner 2003 fand in Wien ein State-of-the-Art-Symposium zum Thema „Stimmenhören“ statt. Das vorliegende Buch stellt eine überarbeitete Zusammenfassung der dort gehaltenen Vorträge dar. 3-6% der erwachsenen Bevölkerung erleben zumindest einmal im Leben das Phänomen des Stimmenhörens, bei Kindern sind es gar 8%, ergaben epidemiologische Studien. Auslöser sind bei 70% der Betroffenen Traumata. Dass der Schluss Stimmenhören ist gleich Schizophrenie nicht mehr zulässig ist, bestätigte sich ebenso in Untersuchungen. Denn Stimmenhören kann nicht nur bei anderen Erkrankungen, sondern auch bei psychisch weitgehend gesunden Menschen (55% der Betroffenen) auftreten. Krankheitswert erlangt diese Form akustischen Halluzinierens vor allem dann, wenn individuelle Copingstrategien versagen, der Betroffene diese Erfahrung nicht in seinen Lebenskontext integrieren kann. Bewältigungsstrategien Betroffener und Angehöriger werden vorgestellt, neurobiologische, psychoanalytische und anthropologische Aspekte diskutiert und psychoedukative, medikamentöse und psychotherapeutische Behandlungsstrategien skizziert. Zuletzt wird betont, dass ein differenzierter, auf Verstehen und Akzeptanz zielender Zugang zu diesem Phänomen nicht nur dem Betroffenen hilft, sondern auch zur Entstigmatisierung beiträgt. Eine empfehlenswerte und bereichernde Lektüre für Betroffene, Angehörige und professionelle Helfer.
Mag. Dr. Herwig Oberlerchner
Poscheschnik Gerald (Hg.): Empirische Forschung in der Psychoanalyse. Grundlagen – Anwendungen – Ergebnisse.
Psychosozial-Verlag: Giessen. 2005. ISBN 3-89806-477-8.
Zu Beginn des Jahres 2001 wurde von engagierten und an der Themenvielfalt der Psychoanalyse interessierten Studenten und Mitgliedern der Universität Klagenfurt die Klagenfurter Psychoanalytische Mittwoch-Gesellschaft gegründet mit der Idee durch Organisation öffentlicher Vorträge einem breiten Publikum die Lebendigkeit und Aktualität der Psychoanalyse nicht nur als Psychotherapieform sondern auch als Wissenschaft der unbewussten Prozesse und als Kulturtheorie vor Augen zu führen. Aus diesen breit gefächerten Vorträgen entstand das Buch „Psychoanalyse im Spannungsfeld von Humanwissenschaft, Therapie und Kulturtheorie“, erschienen bei Brandes & Apsel (Poscheschnik und Ernst 2003). Diese Vortragsreihe konnte noch eine Zeitlang fortgesetzt werden und drei Beiträge (Bänninger-Huber, Schüssler, Streeck) stellen nun den einen Teil des vorliegenden Sammelwerkes dar, daneben konnte der Herausgeber namhafte Autoren für Beiträge zum Thema Empirische Forschung in der Psychoanalyse gewinnen.
Noch immer ist die Meinung weit verbreitet, die Psychoanalyse lasse sich mit empirisch wissenschaftlicher Methodik nicht untersuchen, ja wird der Psychoanalyse oft sogar Wissenschaftlichkeit und damit Glaubwürdigkeit, Nachvollziehbarkeit und Gültigkeit abgesprochen. Auf diesen Unwissenschaftlichkeitsvorwurf kann nun, so der Herausgeber Gerald Poscheschnik in der Einleitung, defensiv reagiert werden (Rückzug in die Privatpraxis, Ideologisierung, Mystifikation und Diskussionsverweigerung) oder offensiv. Zwei Forschungstraditionen ortet Poscheschnik seit Freuds Zeiten, die poetische Forschung, die anhand von Fallvignetten, Anekdoten oder gar Romanen faszinierende Einblicke in die Exklusivität der Begegnung zwischen Therapeut und Klient erlaubt, ohne jedoch die Psychoanalyse dadurch der Wissenschaftlichkeit näher zu bringen und die empirische Forschung in der Psychoanalyse als stärker offensive, zweite Tradition, gegen die noch letzte Ressentiments auch bei einer großen Zahl der Psychoanalytiker abgeschüttelt werden müssen. Denn obwohl wissenschaftliche Weiterentwicklung in den Satzungen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften verankert ist, gibt es in der Psychoanalyse „bezüglich eines solchen Wissenschaftsverständnisses und der Notwendigkeit von Forschung viele Appelle und wenig Überzeugte“, schreibt Gerd Rudolf in seinem Beitrag „Psychoanalyse und Forschung: Unüberwindliche Gegensätze?“ (S. 64). Die fehlende oder unzulängliche Forschungsaktivität und unbefriedigende Datenlage trotz einiger in letzter Zeit qualitativ hochwertiger Wirksamkeitsstudien ortet Rudolf zum Teil in der Sozialisation der Psychoanalytiker und sieht in deren beruflicher Entwicklung und Ausbildung die Hauptgründe für ihre Scheu vor Wissenschaftlichkeit. Die Kandidaten sieht Rudolf von einer kleinen aber meinungsbestimmenden Gruppe von Psychoanalytikern in ihrer wissenschaftskeptischen Haltung beeinflusst, die er als „wortmächtige theologische Fraktion“ bezeichnet und die appelliert, die „wahre Lehre“ nicht zu verraten (S. 73). Dass psychoanalytische Forschung trotz dieser Schwierigkeiten möglich ist, belegt Rudolf anhand einiger Beispiele.
Liest man den Beitrag Siegfried Zepfs, der sich in seinem Artikel (Die „empirische“ Beforschung der psychoanalytischen Therapie – Einige epistemologische und methodologische Anmerkungen) (S. 77 ff) mit methodologischen Voraussetzungen der Psychotherapieforschung auseinandersetzt und vor einem simplifizierenden Wissenschaftsverständnis warnt, wird meines Erachtens ein weiterer im Buch nicht erwähnter Grund für die Scheu vor empirischer Forschung sichtbar. Solche Texte wie der von Zepf sind auch in einem Fachbuch nicht geeignet, Interesse und Forschungsgeist zu schüren. Dazu ein kurzes Zitat (vgl.: Zepf S. 81 f):
„Die Annahme einer invarianten Beziehung geht mit der Annahme vieler Invarianzen einher. Im nomologischen Verständnis können sich diese Invarianzen überlagern und daher als Invarianzen nicht besonders deutlich hervortreten. Soll die Behauptung einer einzelnen Invarianz überprüft werden, ist damit zu rechnen, dass wegen der Überlappung der vielen Invarianzen die behauptete Invarianz nicht sichtbar wird, obwohl sie besteht, oder dass eine Invarianz vorzuliegen scheint, wo keine vorliegt. Die Suche nach einer einzelnen Invarianz ist dadurch beeinträchtigt, dass sich ihre Wirkung mit der anderer Invarianzen überschneidet. Sie gelten als störende Bedingungen gegenüber der Invarianz, auf die sich die Suche richtet.“
Solche Beiträge, die ausgewählten Zeilen repräsentieren den Gesamttext, verderben, schlicht ausgedrückt, den Appetit auf die folgenden Gänge.
Nach diesen zwei Beiträgen zu den Grundpositionen der Debatte geht es im zweiten Teil des Buches um psychoanalytische Experimentalforschung. Thomas Köhler setzt sich im folgenden mit experimentellen Studien zur freudschen Lehre von Widerstand und Verdrängung auseinander. Die Ergebnisse der präsentierten Assoziationsstudien belegen die Gültigkeit dieser beiden zentralen psychoanalytischen Hypothesen.
Ein weiteres Thema empirischer Forschung in der Psychoanalyse betrifft die Traumtheorie. Tamara Fischer und Wolfgang Leuschner geben in ihrem Beitrag „Kann die psychoanalytische Traumtheorie experimentell gestützt werden“ (S. 121 ff) zuerst einen geschichtlichen Überblick über experimentelle Traumforschung, beginnend mit Alfred Maury Mitte des 19. Jahrhunderts, gefolgt von Schrötter 1912, später gefolgt von den wichtigen „tachistokopischen“ Experimenten Pötzls. Fischer und Leuschner zeigen, dass zentrale Annahmen Freuds (Die Bedeutung von Tagesresten für die Traumgestaltung, der Zugang zum latenten Traum über die freie Assoziation, die Bedeutung des Unbewussten, Vorbewussten und subliminaler Wahrnehmungsinhalte, bestimmte Mechanismen der Traumarbeit) experimentell beweisbar sind. Schwieriger fällt hingegen der Beweis der Wunscherfüllungstheorie.
Martin Dornes stellt in seinem Beitrag die Frage, ob die Kleinkindforschung relevant für die Psychoanalyse ist und präsentiert diese spannende Diskussion anhand zweier Protagonisten, einerseits Andre Green, Vertreter der Wissenschaftsskeptiker, die durch eine Annäherung an die empirische Wissenschaft im allgemeinen und der Säuglingsforschung im besonderen das Ureigenste der Psychoanalyse (das Interesse am Infantilen im Erwachsenen) verraten sehen und andererseits Daniel Stern, Verteidiger der Meinung Säuglingsforschung unterstützt, erweitert und ergänzt Hypothesen der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie.
Kai von Kitzling betont in seinem Beitrag und dem darin enthaltenen Fallbeispiel wie Dornes den potentiell befruchtenden Dialog zwischen Entwicklungsforschung und Psychoanalyse.
Den faszinierendsten Beitrag liefern im Abschnitt über Psychoanalytische Entwicklungsforschung jedoch Peter Fonagy und Mary Target. Sie relativieren die Ansicht der Verhaltensgenetiker, die meinen belegen zu können, dass unsere psychischen Dispositionen oder Funktionsstörungen fast ausschließlich durch unsere Erbanlagen bedingt sind und Erziehung und Umwelt kaum einen Einfluss haben, mehr noch, sie präsentieren erste Studienergebnisse, in denen evident wird, dass Interaktionserfahrungen in der Kindheit, in der Erziehung und auch in der Psychotherapie via Beeinflussung der Genexpression ein allfällig vorhandenes genetisches Risiko reduzieren können. In diesem Beitrag kündigt sich die Überwindung der Gen-Umwelt Kontroverse für die Zukunft an.
Der vierte Teil des Buches ist nun der psychoanalytischen Therapieforschung gewidmet. Den Reigen der Beiträge eröffnet Falk Leichsenring, der einen ausführlichen Überblick über die Wirksamkeitsstudien zu psychoanalytischer und tiefenpsychologisch fundierter Therapie gibt. Leichsenring differenziert in seiner Darstellung einerseits zwischen den je nach Dauer und Setting verschiedenen Arten psychodynamischer Therapie und andererseits nach den behandelten Störungsbildern. Die empirischen Belege für die Wirksamkeit sind eindeutig.
Ulrich Streeck befasst sich im nächsten Beitrag mit dem interaktiven Geschehen zwischen Klient und Therapeut. Er präsentiert Untersuchungen zum mimisch-gestischen also nicht sprachlichen Interaktionsverhalten anhand von audio- und videographierten Protokollen. Diese interaktiven Mikroprozesse und Inszenierungen neben dem narrativen Prozess können analog zu den Ergebnissen der Säuglingsforschung weitreichende Wirkung haben (Stichwort: projektive Identifikation, Responsibilität).
Der nächste Beitrag stammt von Rainer Krause. In den frühen Dyaden spielen sich Interaffektivitätsmuster ab, die vom Patienten später beibehalten werden. Daraus erklärt sich besser als über die Genetik das Phänomen der transgenerationalen Weitergabe psychischer Strukturen Diese erlernte Kommunikation über unbewusste Mikroaffekte und Verhaltensweisen setzt der Erwachsene später fort und drängt den Gesprächspartner oder den Therapeuten zu reziprokem Verhalten. Insbesondere der psychisch kranke Mensch induziert dadurch im Gegenüber potentiell ein Verhalten, wodurch er Grundannahmen über sich und seine Weltsicht bestätigt sieht. Dieser unbewusste Synchronisierungsdruck kann durch bestimmte Forschungen sichtbar gemacht werden. Daneben zeigen Studienergebnisse eindrucksvoll, dass emotionales Mitschwingen ohne das Anbieten alternativer und vom Patienten unbewusst ausgeklammerter Affekte seitens des Therapeuten sehr häufig mit Therapiemisserfolgen korreliert. Ein diesem Anpassungsdruck aktives Gegensteuern seitens des Therapeuten kann dem gegenüber jedoch zu korrigierenden emotionalen Erfahrungen verhelfen, in der Biographie verloren gegangene Affekte wieder beleben.
Ebenfalls mit dem Thema Klinische Emotions- und Interaktionsforschung beschäftigt sich Eva Bänninger-Huber in ihrem Beitrag. Durch Analyse von Videoaufnahmen von Therapiesitzungen werden spezifische beziehungsdynamische Verhaltenssequenzen untersucht und dadurch psychoanalytische Konzepte wie Übertragung, Gegenübertragung oder Widerstand operationalisiert. Diese Mikroprozesse zu verstehen, gar bewusst einsetzen kann dem Patienten einerseits Sicherheit bieten und das Arbeitsbündnis verstärken, andererseits bleibt ausreichend Konfliktspannung erhalten, um eingeschliffene Muster von Emotions- und Interaktionsregulierung zu verändern.
Während die vorhergehenden Beiträge den nonverbalen, mimischen und gestischen interaktions- und affektregulierenden Prozessen gewidmet waren, setzt sich Brigitte Boothe mit der Dynamik des Erlebens in der Patientenerzählung auseinander. Im Erzählen will der Klient unterhalten und umwerben, uns an seinen Rollen und Konflikten in der Vergangenheit, reaktiviert durch die und reinszeniert in der therapeutischen Begegnung teilhaben lassen. Boothe präsentiert anhand eines Fallbeispiels die erzählanalytische Methodik.
John Bowlbys Bindungstheorie, am Beginn ihrer Entstehung von Protagonisten der Psychoanalyse noch abgelehnt, ist bezüglich ihres befruchtenden Einflusses auf die Psychoanalyse wohl unumstritten, gehen doch auch beide Ansätze von vergleichbaren Annahmen aus. In der Kindheit entstandene Bindungsrepräsentationen, wie sie in den Therapien durch Erzählungen erkennbar werden oder sich in der Beziehungsgestaltung wiederholen, können zum Beispiel durch das Adult Attachement Interview (AAI) klassifiziert werden. Anhand von drei Beispielen illustriert Anna Buchheim den spannenden Dialog zwischen Bindungstheorie und Psychoanalyse.
Gerhard Schüssler stellt im Buch jenes bereits recht gut bekannte, mehrachsige, der komplexen psychoanalytischen Krankheitstheorie Rechnung tragende und insbesondere die Psychodynamik berücksichtigende Klassifikationsschema OPD (Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik) dar. Angekündigt wird die OPD-2, die sich stärker der Focusformulierung und darauf aufbauenden Therapiezielbestimmung widmen wird.
Diese empirische Forschung in der Psychoanalyse orientieren sich nun, wie es im Buch eindrucksvoll deutlich wird, nicht mehr an den bereits als überholt geltenden „klassischen“ Wissenschaftsidealen wie der ausschließlichen Verwendung quantitativer Forschungsansätze oder dem Untersuchen großer Populationen, sondern verwendet Methoden, die den Besonderheiten der Psychoanalyse Rechnung tragen (Einzelfallanalyse, Dokumentenanalyse, Handlungs- und Aktionsforschung, Feldforschung, Evaluationsforschung und Experimentalforschung).
Von der Gestaltung und den Ergebnissen dieser Forschungsansätze geben nun die einzelnen Beiträge im Buch eindrucksvoll Auskunft und belegen die Psychoanalyse als Humanwissenschaft. Nach der Lektüre gelangt man mit Poscheschnik zur ermutigenden Erkenntnis, dass die Psychoanalyse nicht nur den Rang einer vollwertigen Wissenschaft für sich beanspruchen kann, als auch aufgrund guter empirischer Fundierung psychoanalytischer Theorie und Praxis diese Wissenschaftlichkeit offensiv vertreten werden kann.
Was aber sind noch zu erarbeitende Standards, die diese nach der Lektüre des vorliegenden Readers unbestreitbare Wissenschaftlichkeit noch stärker nach außen transparent machen würden? „Faustregeln empirischer Forschung“ (S. 39) nennt der Herausgeber jene zu fordernden Standards, die für ihn die intersubjektive Wahrheit über die verwendeten Begriffe, Abschied von jeglicher Dogmatik und Offenheit für Modifikationen, umfassende Reflexion des gesamten Forschungsprozesses, Bereitschaft zu intra- und interdisziplinärem Dialog und Transparenz des methodischen Vorgehens sind.
Insgesamt ein empfehlenswertes, inhaltlich hoch aktuelles, wichtiges, phasenweise sehr anspruchsvolles Buch, das sich an alle an psychoanalytischen Themen Interessierte richtet.
Mag. Dr. Herwig Oberlerchner
Nachtzug nach Lissabon, von Pascal Mercier (als Taschenbuch bei btb)
Klappentext: „Mitten im Unterricht steht der Lateinlehrer Raimund Gregorius auf und verlässt seine Klasse. Aufgeschreckt vom plötzlichen Gefühl der verrinnenden Zeit, lässt er sein wohlgeordnetes Leben hinter sich und setzt sich in den Nachtzug nach Lissabon. Im Gepäck hat er ein Buch von dem Portugiesen Amadeo de Prado, dessen Ausführungen über das Leben, über Liebe, Einsamkeit, Endlichkeit, Freundschaft und Tod ihn nicht mehr loslassen. Er macht sich auf die Suche nach den Spuren dieses faszinierenden Menschen. Langsam meint Gregorius zu ahnen, wer der Schriftsteller war. Doch was hat das für Konsequenzen für sein eigenes Leben? Kann man denn einfach so ausbrechen und alles Gewohnte hinter sich lassen? Dieser Roman ist ein vielstimmiges Epos von einer Reise nicht nur durch Europa, sondern auch durch unser Denken und Fühlen.“
Der Autor, 1944 in Bern geboren, ist Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin.
Als Kostprobe zwei kurze Ausschnitte:
„ (..) Wir leben hier und jetzt, alles, was vorher war und an anderen Orten, ist Vergangenheit, zum größten Teil vergessen und als kleiner Rest noch zugänglich in ungeordneten Splittern der Erinnerung, die in rhapsodischer Zufälligkeit aufleuchten und wieder verlöschen. So sind wir gewohnt, über uns zu denken. (..)
Doch aus der Sicht des eigenen Inneren verhält es sich ganz anders. Da sind wir nicht auf unsere Gegenwart beschränkt, sondern weit in die Vergangenheit hinein ausgebreitet. Das kommt durch unsere Gefühle, namentlich die tiefen, also diejenigen, die darüber bestimmen, wer wir sind und wie es ist, wir zu sein. Denn diese Gefühle kennen keine Zeit, sie kennen sie nicht, und sie anerkennen sie nicht. Es wäre natürlich falsch, wenn ich sagte: Ich bin noch immer der Junge auf den Stufen vor der Schule, der Junge mit der Mütze in der Hand, dessen Blick hinüberwandert zu der Mädchenschule, in der Hoffnung, Maria Joao zu sehen. Natürlich ist es falsch, inzwischen sind mehr als dreißig Jahre verflossen. Und doch ist es auch wahr. Das Herzklopfen vor schwierigen Aufgaben ist das Herzklopfen, wenn Senhor Lancoes, der Mathematiklehrer, das Klassenzimmer betrat; in der Beklommenheit allen Autoritäten gegenüber schwingen die Machtworte des gebeugten Vaters mit; und trifft mich der leuchtende Blick einer Frau, so stockt mir der Atem wie jedes Mal wenn sich, von Schulfenster zu Schulfenster, mein Blick mit demjenigen von Maria Joao zu kreuzen schien. Ich bin immer noch dort, an jenem entfernten Ort in der Zeit, ich bin dort nie weggegangen, sondern lebe ausgebreitet in die Vergangenheit hinein, oder aus ihr heraus. Sie ist Gegenwart, diese Vergangenheit, und nicht bloß in Form kurzer Episoden des aufblitzenden Erinnerns. (..)“ (S. 284 f.)
„Ich erzittere beim bloßen Gedanken an die ungeplante und unbekannte, doch unausweichliche und unaufhaltsame Wucht, mit der Eltern in ihren Kindern Spuren hinterlassen, die sich, wie Brandspuren, nie mehr werden tilgen lassen. Die Umrisse des elterlichen Wollens und Fürchtens schreiben sich mit glühendem Griffel in die Seelen der Kleinen, die voller Ohmacht sind und voller Unwissen darüber, was mit ihnen geschieht. Wir brauchen ein Leben lang, um den eingebrannten Text zu finden und zu entziffern, und wir können nie sicher sein, dass wir ihn verstanden haben. (..)“ (S. 318 f.)
Christian Schacht
Carlos Watzka, Marcel Chahrour (Hg.): VorFreud. Therapeutik der Seele vom 18. bis zum 20. Jahrhundert
Wiener Gespräche zur Sozialgeschichte der Medizin.
Verlagshaus der Ärzte. Wien. 2008. ISBN: 978-3-902552-21-1
Die Wiener Gespräche zur Sozialgeschichte der Medizin standen im Freudjahr 2006 unter dem Motto „VorFreud – Therapeutik der Seele vom 18. bis zum 20. Jahrhundert“. Die einzelnen Präsentationen wurden nun im vorliegenden Reader veröffentlicht und spannen einen weiten Bogen bezüglich Auseinandersetzung und Umgang mit der menschlichen Psyche vor der Ära Freud.
Vorweg, ein sehr spannendes, anregendes und interessantes Buch, dessen erstes Kapitel „Zur Institutionsgeschichte der Psychiatrie“ mit dem Zugang der Kirche zur Behandlung und Betreuung psychisch Erkrankter beginnt, mit der Beschreibung der psychiatrischen Großinstitutionen Hall in Tirol und Feldhof bei Graz zur damaligen Zeit fortsetzt und in der Darstellung eines spannenden, auch heute noch sehr aktuellen Konfliktes gipfelt. Im Jahr 1834 wird der Primarius von Hall, Anton Pascoli, in einem eskalierenden „sozialen Drama“ entlassen, was eine Wende im Konflikt „Psychiker versus Romantiker“ bedeutet.
Im nächsten Kapitel „Zur Ideengeschichte der Psyche vor/bis Freud“ setzen sich die Autoren mit Quellen und Texten auseinander, die einen vertiefenden, psychohistorischen Einblick in jene Ära bieten. Tagebuchanalysen zum Thema Tod werden ebenso angeboten, wie Diskussionen zur Urheberschaft psychoanalytischer Paradigmen anhand Schopenhauerscher Textstellen, dieses Kapitel führt aber auch zur Homöopathie Hahnemanns, zur Seelendiätetik Feuchterslebens, zur Mediengeschichte des Unbewussten … Im dritten und letzten Kapitel „Sexualität zu Zeiten Freuds und danach“ schließlich wird die „Sexualtherapie“ jener Ära skizziert, geprägt von Vorurteilen, schlichtem Unwissen und ängstlicher Abwehr, bis zu den revolutionären Texten und Ansichten Freuds, auch zum Thema Homosexualität.
Sehr lesenswert!
Mag. Dr. Oberlerchner Herwig – Klagenfurt, Juli 2008.
Anna KOELLREUTER (Hg.): „Wie benimmt sich der Prof. Freud eigentlich?“
Ein neu entdecktes Tagebuch von 1921 historisch und analytisch kommentiert. Psychosozial-Verlag, Giessen 2009
Klappentext:
Eine junge Ärztin begibt sich 1921 zu Freud in Analyse. In einem Tagebuch hält sie fest, was sie bewegt. Inspiriert von diesen Aufzeichnungen machen sich PsychoanalytikerInnen und GeschichtsforscherInnen Gedanken zu Freud und seiner Arbeitsweise.
Dieser Fund „kommt für die Wissenschaftsgeschichte einer kleinen Sensation gleich. Es ist das Zusammentreffen von drei Faktoren, das dieses Tagebuch zu einem einzigartigen Dokument macht: Erstens handelt es sich hier um eine reine Patientenanalyse, im Unterschied zu einer Lehranalyse, zweitens fand sie vor Freuds Krebserkrankung statt, und drittens sind die Notizen anscheinend wörtlich notierte Niederschriften dessen, was im Behandlungszimmer gesagt wurde. (..) Unter den bisher veröffentlichten Dokumenten gibt es keines, bei dem alle drei Kriterien zutreffen.“ Ernst Falzeder in: DIE ZEIT
Mit Beiträgen von Thomas Aichhorn, Karl Fallend, Ernst Falzeder, John Forrester, Lilli Gast, André Haynal, Rolf Klüwer, Anna Koellreuter, Sebastian Krutzenbichler, Bernhard Küchenhoff, Ulrike May, Juliet Mitchell, Paul Parin, Pierre Passett, Claudia Roth, August Ruhs, Anne-Marie Sandler und Rolf Vogt.
Mich haben die Beiträge von P.Passett, E. Falzeder und J.Forrester am meisten beeindruckt. Passett formuliert kluge, respektvoll-kritische Gedanken zu Freuds „Technik“; Falzeder bringt eine Fülle interessanter historischer Hinweise. Und Forresters Beitrag scheint mir geradezu als Inbegriff einer neugierig-nachdenklichen analytischen Haltung, in der auch die „Lese-Szene“ mitreflektiert wird, oft in poetisch-dichten Formulierungen. Als Beispiel zitiere ich seine Bemerkungen über den letzten Abschnitt des Tagebuchs, eine Traumerzählung, die mit dem Satz endet „Ein Polizist verfolgt uns.“ Forrester dazu: „Es ist nicht sehr weit hergeholt, darauf zu schließen, dass Freud dieser Polizist ist (wie er auch der Mann sein mag, mit dem sie flieht). Er ist sozusagen mit ihrem Fall betraut.
Die Hinweise verflüchtigen sich. Sie hat uns, der heutigen Polizei, keine weiteren Indizien hinterlassen, um ihre Spur aufzunehmen – mit Ausnahme jener, die ihr späteres Leben liefert. (..)“ (S. 254)
Christian Schacht
Raimund Bahr (Hg.): Das Unbehagen bleibt. Texte zur Geschichte der Psychoanalyse. Wien – St. Wolfgang (Edition Art Science) 2008. 206 Seiten, 14 €. ISBN 978-3-902157-49-2.
Die Beiträge dieses kleinen Buches behandeln zunächst die Geschichte der Psychoanalyse in Lateinamerika, vor allem in Argentinien, und die Einflüsse europäischer Emigranten, insbesondere von Marie Langer; den Aufschwung und die traumatische Niederlage der „Plattform“, einer politisch engagierten Bewegung der angewandten Psychoanalyse im Argentinien der 1970er Jahre; Überlegungen zur Traumatisierung und Therapie eines politischen Emigranten aus der Türkei und zur Remigration eines Psychoanalytikers nach Spanien.
Raúl Párama-Ortega (Mexiko) stellt die Frage nach einem günstigen bzw. ungünstigen Nährboden für psychoanalytisches Gedankengut und vergleicht Europa mit Lateinamerika.
Die verspätete Rezeption der Psychoanalyse in Lateinamerika und ihren schwachen kulturellen Einfluss führt er auf die Unterentwicklung, die hohe Analphabetenrate, aber auch auf Probleme bei der Übertragung von Ideen aus dem Deutschen ins Spanische zurück.
Zahlenmäßig ist die Psychoanalyse in Argentinien, Brasilien und Mexiko am stärksten vertreten. Mexiko, Brasilien und Uruguay wurden stark von Argentinien befruchtet.
Die Qualität der Psychoanalyse korrespondiert mit der soziokulturellen Situation des jeweiligen Landes. Mexiko befinde sich gegenwärtig in „einer dekadenten, gefährlichen Nähe zu sozialen Fäulnissen: Korruption, Drogengeschäfte, Kriminalität“.** Im Gegensatz zu den stark politisierten Argentiniern sind die Psychoanalytiker in Mexiko „eher konservativ und scheuen sich, gegen die alarmierende politische Situation ihre Stimme zu erheben.“
Generell laufe die Psychoanalyse „ständig Gefahr, sich dem herrschenden sozialen System a-kritisch anzupassen, keine Diagnose zu liefern.“ Die gesellschaftskritische Tradition der Freudschen Psychoanalyse sei in Lateinamerika fast verloren gegangen.
Die Unterentwicklung in Lateinamerika sei eng der Katastrophe der gewaltsamen Eroberung des Kontinents verbunden. Im Zentrum des kollektiven Gedächtnisses, aber auch des kulturellen Unbewussten, stünde ein Erbe traumatischen Inhalts.
Der verbreitete Analphabetismus als eine direkte Folge des wirtschaftlichen Elends stelle einen ungünstigen Nährboden für das Ziel der Psychoanalyse, die Erweiterung des Bewusstseins, dar. In Lateinamerika sei es daher vonnöten, Erziehung und Psychohygiene (das sogenannte Kupfer) mit dem Gold der psychoanalytischen Deutungen zu vermengen: „Kenntnisse zu übermitteln ist auch eine aufklärende Aktion, die schädliche Unwissenheiten aufdeckt, auch wenn diese ihrerseits nicht in Verdrängung und unbewussten Widerständen wurzeln, sondern einfach in Analphabetismus.“
Pedro Grosz (Schweiz) erzählt die Geschichte der Psychoanalyse in Argentinien aus dem Blickwinkel eines aktiven Mitstreiters der „Plattform“. Der Autor verschränkt sie mit der konfliktreichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Geschichte des Landes im 20. Jahrhundert.
Schon in den 1930er Jahren war in intellektuellen Kreisen Argentiniens über Freud und die Psychoanalyse zustimmend und ablehnend diskutiert worden. Die Menschen waren begierig auf alles, was sie an Kultur und Neuerungen aus der alten Welt erfahren konnten. Bis 1940 gab es in Buenos Aires aber noch keinen Psychoanalytiker.
Als achtgrößtes Land der Erde und als bedeutender Rohstofflieferant erlebte Argentinien in den Jahren des 2. Weltkrieges einen enormen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Der Aufstieg des weitgehend unbekannten Offiziers Juan Domingo Peróns zum Präsidenten (1946) verdankte dieser „der Sehnsucht der sozial benachteiligten Massen nach einer Führerfigur, seinem Charisma und seinem Intrigenspiel.“
Als Folge des 2. Weltkriegs war es zu einer großen Einwanderungswelle aus Europa gekommen. Unter den Einwanderern befanden sich auch die Psychoanalytiker Angel Garma (Madrid), Celes E. Cárcamon (geboren in Argentinien, ausgebildet in Paris) und Marie Langer (Wien). Sie kamen aus einem verblutenden Europa mit der Hoffnung nach Argentinien, „neu beginnen zu können, die Sache besser zu machen, … entschlossen, das was in Europa passierte, nie mehr zuzulassen.“ Die Argentinier „empfingen die Einwanderer mit offenen Armen, … begeistert von jedem kulturellen Beitrag, der aus dem fernen Europa kam.“
1942 wird die Argentinische Psychoanalytische Vereinigung (APA) gegründet, 1949 wird sie von der IPA anerkannt. Fachleute aus ganz Lateinamerika bilden sich nun in Buenos Aires aus. Diese Pionierzeit war von Begeisterung und Einsatz geprägt. Alle Psychoanalytiker arbeiteten in ihren Praxen und in Institutionen und nahmen regen Anteil am kulturellen Leben. Man wollte so viele Menschen wie möglich erreichen. Innerhalb der APA fand die traditionelle Ausbildung statt, außerhalb gewinnen Psychoanalytiker immer mehr Einfluss im gesamten Bereich der Kultur. 1953 hatte die APA 68 Mitglieder und es erschienen viele bemerkenswerte Publikationen.
Nach dem 2. Weltkrieg gab es in Argentinien Vollbeschäftigung, hohe Löhne, gefüllte Staatskassen und eine optimistische, ja euphorische Stimmung. Das „Goldene Zeitalter“ war angebrochen. Die Psychoanalyse konnte davon profitieren. Unter Eva Peróns Schirmherrschaft kam es zu Verbesserungen in der sozialen Fürsorge, an denen sich viele Analytiker beteiligten. In diesem Umfeld kam es zu einer besonders großen Verbreitung psychoanalytischen Gedankentums.
Dennoch misstraute der Großteil der Psychoanalytiker Perón und fürchtete trotz des Aufschwungs seine nationalistische und militärische Herkunft. Das System Perón baute auf dieser Überfluss-Situation auf, auf hohen Konsum und Vollbeschäftigung. Als diese zurückgingen, wurde seine Politik „brüchig, widersprüchlich und brutal, überwältigt von einer Realität, die mächtiger war als jeder Optimismus.“ Perón griff zu den repressiven Maßnahmen eines Diktators. 1955 wurde er vom Militär gestürzt.
In der vibrierenden politischen Unruhe der Jahre danach konnte sich die Psychoanalyse weiter ausbreiten und an Ansehen gewinnen. Psychoanalytiker unterrichten an der Universität, sprechen im Radio und publizieren in Zeitungen und Magazinen in einem Umfang, dass der damalige IPA-Präsident verwundert meint: „Für mich bleibt es ein Rätsel, wie ihr es fertig bringt, dass so viele Menschen so vieles für die Psychoanalyse tun.“ Aus Diskussionen von Psychoanalytikern und anderen Therapeuten über berufspolitische Fragen entsteht schließlich die Gewerkschaft „Trabajadores de la salud mental“.
In den 1960er Jahren verdüsterte sich der politische Horizont Argentiniens zunehmend. Streiks und Besetzungen nehmen zu. Die Politik polarisierte sich. Auch innerhalb der Psychoanalyse kam es zu einer Polarisierung. Schon 1954 war beschlossen worden, dass nur noch Ärzte zu Psychoanalytikern ausgebildet werden. Die APA wurde immer formeller und es setzte eine „Bürokratisierung“, insbesondere zu Fragen der Ausbildung und der „richtigen“ Technik ein.
Nicht zuletzt unter der Fernwirkung der Ausstrahlung der kubanischen Revolution bildete sich in der APA eine Gruppe linker Psychoanalytiker – fast paradoxerweise – denn die kubanische Revolution machte sehr schnell Schluss mit der Psychoanalyse in Kuba. Man wollte die Kubaner überzeugen, dass es auch eine andere Psychoanalyse gäbe, sah sich genötigt, Freud zu überdenken, entdeckte Wilhelm Reich (mit Ausnahme seiner Orgon-Theorien), die freudsche Linke und interessierte sich für Erich Fromm.
Im Juni 1969 kommt es zu einem Militärputsch. Die Repression gegen Gewerkschafter und Studenten nahm zu, aber auch die Aktivitäten von Untergrundkämpfern. Auf diesem Hintergrund erlebten die Argentinier im Juli 1969 den IPA-Kongress in Rom mit dem Thema: „Protest und Revolution“. Es war die Zeit der Studentenrevolte. Eine oppositionelle Gruppe der Psychoanalytiker gründete die „Internationale Plattform“. Schweizer und Argentinische Analytiker waren dabei federführend.
1971 wird Alejandro Lanusse Präsident in Argentinien. Die Situation liberalisiert sich und die Psychoanalyse kann sich, ähnlich wie in ihren Anfängen, wieder ausbreiten. Es ist die Zeit des größten Erfolges für die Plattform. Die Plattform entstand 1969 und befasste sich mit drei zentralen Fragen: Einer kritischen Überprüfung der psychoanalytischen Theorie und Ausbildung; mit der Anwendung der Psychoanalyse und mit der sozialen Zugehörigkeit der Psychoanalytiker.
Zur selben Zeit wird Salvador Allende in Chile zum Präsidenten gewählt. Auch dort interessiert man sich für eine angewandte Psychoanalyse in der sozialen Fürsorge nach dem Vorbild der Plattform.
Plattform fordert von der APA Veränderungen. Diese verlangt von ihren Mitgliedern, sich in der gegenwärtigen Situation nicht politisch zu betätigen. 1971 kommt es zum Bruch.
Die politische Situation glich immer mehr der eines Bürgerkrieges. Im Jahr 1973, mit der Rückkehr Peróns ins Präsidentenamt, begann die politische Repression. Immer mehr Leute wurden verfolgt, gefoltert, ermordet, „verschwanden“, darunter auch viele Mitglieder der Plattform. Einige konnten sich ins Ausland retten.
Manche Psychoanalytiker wandten sich dem Studium von Lacans Theorien zu und bedienten sich zwischen 1974 und 1984, in den Jahren der Repression, „einer snobistischen, absurden Linguistik“, wie der Autor schreibt. Viele Lacanianer nahmen die freigewordenen Plätze jener ein, die der Repression zum Opfer gefallen waren. Der Autor verweist auf diese und andere offenen Wunden in der argentinischen Psychoanalyse.
Die Stellung der Psychoanalyse zwischen den Polen einer unpolitischen Anpassung an die Verhältnisse und ihrer sozialpolitischen Anwendung – bei Gefahr der Überschreitung der Grenze zum reinen Agieren – bleibt eine offene Frage. Der Autor steuert zu dieser Diskussion eine nachdenklich machende Dimension bei. Ganz offensichtlich ist es in der APA nicht gelungen, aufeinander zuzugehen, und viele Mitglieder drifteten – parallel zur Entwicklung in der argentinischen Gesellschaft – politisch nach links und rechts ab, bis es zum völligen Bruch kam.
Der Herausgeber Raimund Bahr (Österreich) befasst sich vor allem mit dem großen Einfluss der Wiener Emigrantin Marie Langer auf die argentinische und lateinamerikanische Psychoanalyse. Ein Kennzeichen der europäischen Emigranten, der „stillen Eindringlinge“ (Spaulding), war ihre Fähigkeit, sich besonders rasch in das aufnehmende Land zu integrieren und zur Veränderung in diesem Land beitragen zu können. Marie Langer kam über Uruguay (1939) im Jahr 1942 nach Buenos Aires, dem „südamerikanischen Paris“.
Als Gründungsmitglied der APA war Marie Langer Teil des Institutionalisierungsprozesses der argentinischen Psychoanalyse, „auch wenn sie in Fragen der weiblichen Entwicklung und der Gruppentherapie von den freudschen Grundsätzen abwich.“ 1951 publizierte sie das Buch „Mutterschaft und Sexus“.
In den Jahren 1969-1974 etablierte sich neben den freudschen und kleinianischen Modellen eine eigenständige argentinische Psychoanalyse. Marie Langer wurde zu einer bedeutenden Figur innerhalb jener PsychoanalytikerInnen, „die sich von den „orthodoxen“ Vereinigungen nicht mehr vertreten fühlten.“ In diesem Loslösungsprozess fand jenes vielbeachtete „argentinische Experiment“ statt, in dem der Autor einen Wendpunkt in der argentinischen Psychoanalysegeschichte sieht: Marie Langer und andere versuchten, „ihre Utopien und die soziale Realität bewusst in die analytische Arbeit einzubeziehen … (und) sich für eine offene, linke und gesellschaftspolitisch wirkende Psychoanalyse zu engagieren.“ Sie bewiesen, dass es eine nicht-institutionelle Psychoanalyse geben kann. Sie wollten nicht „AusbildungskandidatInnen in ihre Verwaltung bekommen, sondern, … die soziale Wirklichkeit in den Ausbildungs- und Arbeitsprozess von PsychoanalytikerInnen“ einführen. Psychoanalytiker sollten, so Marie Langer befähigt werden, „aus ihrer Isolation herauszukommen und solidarische Bindungen herzustellen, jenseits ihrer kleinen privaten Welt.“
Als am 20. Juni 1973 der „argentinische Frühling“ zu Ende ging, mussten Marie Langer und andere emigrieren. Die Erfolge der sozial- und kulturpolitisch engagierten Psychoanalyse überdauerten die Jahre der Diktatur. Buenos Aires ist heute die Stadt mit der größten Analytikerdichte, reich an psychoanalytischen Institutionen, Theorien und Publikationen, und die Psychoanalyse ist im öffentlichen Bewusstsein und in den Medien fest verankert.
Mit Marie Langer befasst sich auch Else Pappenheims (USA) Beitrag. Als Schülerin am Wiener Schwarzwaldgymnasium, aus reichem Haus, gut gekleidet und nonchalant, wusste Marie Langer ihre Frühreife und ihr politisches Engagement vor ihren Mitschülerinnen zu verbergen. Sie war besonders sportlich, hatte ihre erste Affaire mit 15 Jahren, und trotzdem „war immer etwas Mädchenhaftes und fast Scheues in Mimis Verhalten.“ Die großbürgerliche Mutter wollte sie nicht studieren lassen, erwartete, dass sie früh heirate, was die Tochter auch tat. Dennoch maturierte und studierte sie und es kam zu einer einvernehmlichen Scheidung. Else Pappenheim beschreibt das gemeinsame Medizinstudium ab 1929 und die enge Freundschaft und Zusammenarbeit jener Jahre.
Marie Langer verbrachte ein Auslandssemester in Kiel, erlebte dort Versammlungen der Nationalsozialisten und schloss sich nach ihrer Rückkehr in Wien der Kommunisten Partei an. „Sie bewunderte die Erfolge der sozialdemokratischen Stadtverwaltung in Wien ihr ganzes Leben lang, war aber überzeugt davon, dass nur eine Revolution die Welt retten könnte. Sie glaubte nicht an den Erfolg eines evolutionären Fortschritts im Sinne der Sozialdemokratie.“
Im letzten Jahr ihres Studiums begannen beide Freundinnen ihre Lehranalysen. Das erste, was sie Else Pappenheim betrübt erzählte, war, „dass Rauchen während der Stunden verboten war.“
Else Pappenheim nahm an einer Gruppe von zwölf „pazifistischen“ Ärzten teil, die Marie Langer organisiert hatte. Man las Kant und diskutierte mit Edgar Zilsel. Mitglieder der Gruppe wurden von den austrofaschistischen Behörden kurzfristig verhaftet und beschuldigt, sie hätten für „den Frieden“ gearbeitet. Auch die Wiener Psychoanalytische Vereinigung erließ nun die Order: Psychoanalyse oder politisches Engagement. Else Pappenheim entschied sich für ihre Ausbildung, Marie Langer für die Politik. Sie beendet ihre Analyse bei Richard Sterba und schloss sich wenig später als Ärztin den internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg an.
In den beiden ersten Jahrzehnten in Argentinien widmete Marie Langer ihr Leben ganz der Psychoanalyse und ihrer sich vergrößernden Familie. Ihr Mann hatte sie gebeten, sich nicht politisch zu betätigen. Als dieser 1965 starb, schrieb sie an Else Pappenheim, sie könne sich nun nicht länger von der Politik fernhalten: „Psychoanalyse und Marxismus seien die Objekte ihrer Liebe, nun könne sie beide miteinander vereinen … zusammen würden (sie) eine rationalere Welt schaffen.“
Nachdem sie Argentinien 1974 über Nacht verlassen musste, begann sie in Mexiko „Folteropfer zu behandeln, unterrichtete an der Universität und eröffnete eine Privatpraxis. 1981 begründete sie die Gruppe … Salud Mental, die die Arbeit in Nicaragua zum Ziel hatte.“ Im Februar 1986 reiste sie nach Kuba, danach schrieb sie Else Pappenheim: „Ich habe mir einen Lungenkrebs angeraucht.“ Im Dezember 1987 starb sie im Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder.
Für Else Pappenheim war Marie Langer „eine ungewöhnliche Frau. Ich konnte ihre politischen Hoffnungen und Ideale nicht teilen, aber … sie war einer der außerordentlichsten Menschen, die ich jemals gekannt habe. Tief verbunden mit ihrer großen Familie und berührt von den Leiden der Menschheit. Sie glaubte wirklich, das Gute würde über das Böse triumphieren. Sie war auch eine der klügsten und begabtesten Menschen, die ich gekannt habe. Junge Menschen fühlten sich immer von ihr angezogen.“
Emilio Modena (Schweiz) beschreibt in einer berührenden Fallgeschichte das politische Asyl eines politisch linksstehenden türkischen Flüchtlings, die „Invalidisierung eines Revolutionärs“ und die mit ihm durchgeführte Psychotherapie.
Der Mann, der wiederholte schwere Folter in den 1970er Jahren in der Türkei überlebte und äußerlich zunächst gut überstand, dekompensierte nach 14 Jahren, in Folge einer gescheiterten Beziehung und schwieriger Arbeitsverhältnisse. Schwere Depressionen, Somatisierungen und psychosomatische Erkrankungen waren die Folge.
Modenas Überlegungen zur Psyche der Revolutionäre sind besonders hervorzuheben, können hier aber aus Platzgründen nicht gebührend dargestellt werden.
Dasselbe gilt für die spannende Selbst-Analyse einer Remigration. Isidro Férnandez Blasco (Spanien) beschreibt und analysiert die Erfahrungen bei seiner leidvollen aber auch herausfordernden Rückkehr in seine Heimat, nach langen Jahren des Exils in der Schweiz.
Einigen Beiträgen, die bei Veranstaltungen zur Geschichte der Psychoanalyse in Feldkirch, Zürich und in Wien vorgetragen wurden, hätte eine etwas gründlichere Überarbeitung gut getan. In Summe findet man in diesem Buch eine Fülle von Informationen, unübliche Sichtweisen und auch Irritationen, die zum Nachdenken anregen.
** Vgl. dazu den Roman von Roberto Bolaño: 2666. Hanser: München 2009.
Bernhard Handlbauer
Robert Seethaler: „Der Trafikant“. (Roman, Verlag Kein & Aber 2012).
Inhalt: In seinem Roman „Der Trafikant“ erzählt Robert Seethaler (* 1966) von einem 17-Jährigen, der 1937 aus der Provinz nach Wien kommt, um hier als Lehrling in einer Trafik zu arbeiten. Er macht seine ersten sexuellen Erfahrungen und lernt in der Trafik den Stammkunden Sigmund Freud kennen. Vor dem Hintergrund der tragischen politischen Ereignisse rund um den „Anschluss“ Österreichs entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden unterschiedlichen Männern.
Sigmund Freud als Roman- oder als Theaterfigur auftreten zu lassen scheint ein ziemlich riskantes Unternehmen zu sein. (Ich habe etwa ein unsäglich holpriges Theaterstück namens „Berggasse 19“ in Erinnerung, mit Curd Jürgens als Freud…) Als gelungenes Beispiel kannte ich bisher nur den großartigen Roman „Als Nietzsche weinte“ von Irvin D. Yalom. Dort ging es um den jungen Freud, der als Nebenfigur auftaucht (Hauptfigur ist Josef Breuer). Eine Nebenfigur ist Freud nun auch in R.Seethalers Roman, – diesmal allerdings ist es der alte, kranke Freud, mit dem die Hauptfigur Franz einige ungewöhnliche, intensive Gespräche führt.
Zwei kurze Ausschnitte:
S. 42f.: [….]
„Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Professor?“
„Kommt auf die Frage an.“
„Stimmt es, dass Sie den Leuten ihre Schädel wieder gerade richten können? Und ihnen hernach beibringen, wie ein ordentliches Leben ausschaut?“
Freud nahm seinen Hut erneut ab, legte sich sorgfältig eine dünne, schneeweiße Strähne hinters Ohr, setzte den Hut wieder auf und sah Franz von der Seite an.
„Erzählt man sich das in der Trafik oder bei dir zuhause im Salzkammergut?“
„Weiß nicht“, sagte Franz und zuckte mit den Schultern.
„Wir rücken überhaupt nichts gerade. Aber wenigstens renken wir auch nichts aus, und das ist in den heutigen Ordinationen gar nicht so selbstredend. Wir können gewisse Verirrungen erklären, und in manchen eingebungsvollen Stunden können wir das, was wir gerade eben erklärt haben, sogar beeinflussen. Das ist alles“, presste Freud hervor, und es hörte sich an, als ob ihm jedes einzelne Wort Schmerzen bereiten würde. „Aber auch das ist nicht wirklich sicher“, fügte er mit einem kleinen Seufzer hinzu.
„Und wie stellen Sie das alles an?“
„Die Menschen legen sich auf meine Couch und beginnen zu reden.“
„Das klingt gemütlich.“
„Die Wahrheit ist selten gemütlich“, widersprach Freud und hüstelte in das dunkelblaue Stofftaschentuch, das er aus seiner Hosentasche gezogen hatte.
[…]
S. 141f. [….]
„Hm“, meinte Franz und legte eine Hand an seine Stirn, um das wilde Durcheinander seiner Gedanken dahinter ein wenig einzudämmen. „Könnte es vielleicht sein, dass Ihre Couchmethode nichts anderes macht, als die Leute von ihren ausgelatschten, aber gemütlichen Wegen abzudrängeln, um sie auf einen völlig unbekannten Steinacker zu schicken, wo sie sich mühselig ihren Weg suchen müssen, von dem sie nicht die geringste Ahnung haben, wie er aussieht, wie weit er geht und ob er überhaupt zu irgendeinem Ziel führt?“
Freud hob die Augenbrauen und öffnete langsam den Mund.
„Könnte das sein?“, wiederholte Franz. Freud schluckte.
„Warum sehen Sie mich denn so komisch an, Herr Professor?“
„Wie sehe ich dich denn an?“
„Ich weiß nicht. Als ob ich etwas unglaublich Blödsinniges gesagt hätte.“
„Nein, das hast du nicht. Das hast du ganz und gar nicht.“
Freud versuchte ein Lächeln, strich sich dann zerstreut mit den Fingern durch die Haare, nahm seinen Hut vom Knie, setzte ihn auf den Kopf und erhob sich von der Bank.
[….]
C. Schacht
Adler Katharina (2018): Ida. Rowohlt Verlag, Hamburg
„Ich wollte eine Frau zeigen, die man nicht als lebenslängliche Hysterikerin abtun oder pauschal als Heldin instrumentalisieren kann. Eine Frau mit vielen Stärken und auch einigen Schwächen, die trotz aller Widrigkeiten bis zuletzt um ein selbstbestimmtes Leben ringt.“ Katharina Adler
In ihrem Erstlingsroman „Ida“ nimmt die Autorin Katharina Adler den familiären Faden auf und erzählt das Leben ihrer Urgroßmutter Ida Bauer. Als junge Frau war Ida Patientin von Sigmund Freud. In „Bruchstück einer Hysterie-Analyse“ veröffentlichte Freud 1905 Idas Fallgeschichte und gab ihr das Pseudonym Dora.
Katharina Adler schreibt kein Fachbuch über den „Fall Dora“. Es gelingt ihr, das „Bruchstück“ weiterzuerzählen und das Bild einer facettenreichen Ida Bauer in ihrem Beziehungsgeflecht und in einer historisch und politisch brisanten Zeit zu zeichnen – vom Wien um die Jahrhundertwende, dem ersten Weltkrieg, dem Ende der ersten Republik bis zur Flucht über Frankreich und Marokko nach New York.
Es tut sich die Welt eines bourgeoisen, liberalen, jüdischen Wiens auf, in dem Salons Orte des kulturellen, sozialen und politischen Austauschs waren. Für Frauen aus dem bürgerlichen Milieu mögen diese Salons eine Form gesellschaftlicher Teilhabe (Emanzipation?) gewesen sein – so auch für Ida Bauer, die die Gesellschaft namhafter Künstler und Politiker zwar sehr anregend findet aber dennoch um Stimme und Selbstbestimmung ringt.
Ida verlangt von ihrem Bruder Otto, ihr etwas Anspruchsvolleres zu lesen zu geben.
Otto: „(…) Ida, bitte, Das Kapital hast du nicht übers erste Kapitel hinaus geschafft. Hätte es dich interessiert, hättest du dich weiter durchgearbeitet. Aber dein Kopf ist immer überall!“ Ida begann ihre Hände zu kneten. „Es kann sich eben nicht jeder aussuchen, wo sein Kopf hingedrückt wird.“ (S.268)
Nun betritt auch Sigmund Freud die Bühne.
Als LeserIn findet man sich in den Analysestunden mit Ida Bauer und Freud wieder.
Das Behandlungszimmer rauchverhangen, die Blumen verblüht, der Herr Doktor, „…der ihr im Nacken saß, während sie halb sitzend, halb liegend sich ihm darbieten musste“ (S.312). Mit amüsant polemischem Unterton wird ein Freud beschrieben, der sich selbst aus der Traumdeutung zitiert und ein Freud, der „alles verdreht, bloß um im Recht zu bleiben.“
Es zeigt sich die Ambivalenz zwischen Doras aufgeregter Neugier gegenüber den Erkenntnissen in der Kur und ihrem Sträuben vor den „ungeheuerlichen Deutungen“. Während Freud „monologisiert“, zählt Dora in Gedanken Gerichte auf…die Dynamik der Hysterie offenbart sich mehr oder weniger subtil in Gedanken, Gesprächen und Handlungen.
Dora hat mit ihrer Urenkelin eine „Mitstreiterin“ an ihrer Seite. Leichtfüßig spaziert diese durch die Schriften von Freud, Felix Deutsch und Otto Bauer und zögert nicht, das ein oder andere psychoanalytische Hühnchen zu rupfen.
Spannend finde ich es, über die Beziehung zwischen Ida und ihrem Bruder Otto zu erfahren. Packend erzählt wird Zeitgeschichtliches wieder gegenwärtig, bspw. als Otto, ein Sozialdemokrat der ersten Stunde und Begründer des Austromarxismus, die Februarkämpfe erlebt; dank der Hilfe der Genossinnen und Genossen gelingt Ida schließlich die Flucht.
Gerne will ich als Leserin glauben, dass es sich so oder so ähnlich ereignet haben mag. Nicht zuletzt durch die Sprachbilder öffnen sich Räume zum Weiterphantasieren.
Wie hätte wohl Freud dieser Roman gefallen? Hätte er sich mit der Urenkelin über deren Motivation, die Urgroßmutter zu „rehabilitieren“ unterhalten oder wäre auch seine Enttäuschung über das abrupte Ende einer vielversprechenden Analyse zur Sprache gekommen?
In einem Interview auf Ö1 (ex libris, 02.09.2018) erzählt die Autorin, sie habe sich das Kapitel „Diwan“ bis zum Schluss „aufgespart“ bevor sie sich darüber gewagt hat.
Nachdenkenswert finde ich auch, dass es in der Familie Adler offenbar zu einem „Vergessen“ kam – nur durch einen Anruf eines interessierten Analytikers erfuhr der Vater der Autorin, dass seine Großmutter „Die Dora“ war.
Stoff mit leichter Patina, erfrischend unsentimental erzählt!
Petra Digruber
Christian Schacht
Ich komme nicht dazu, so etwas wie ernsthafte Rezensionen zu verfassen. Stattdessen werde ich kurz davon berichten, welche subjektiven Eindrücke die folgenden Bücher jeweils bei mir hinterlassen haben. Vielleicht kann ich auch damit ein bisschen zur Lektüre anregen?
Gleichzeitig lade ich die Leserinnen und Leser ein, für unsere Zeitschrift ebenfalls nicht nur „seriöse“ Buchbesprechungen zu verfassen – die natürlich weiterhin willkommen sind! –, sondern uns auch solche oder ähnliche Kurzberichte über „Lese-Erlebnisse“ zukommen zu lassen.
Wolfgang MERTENS (2018): Psychoanalytische Schulen im Gespräch über die Konzepte Wilfred R. Bions. (Gießen: Psychosozial-Verlag)
Ein großartiges, unglaublich reichhaltiges Buch! Um Bion habe ich bisher eher einen Bogen gemacht, er kam mir schwer verständlich bis „mystisch“ vor. Die fiktive Gesprächsrunde, die Mertens über Bion diskutieren lässt (der an Bion orientierte Psychoanalytiker; der Laie; die klassische Freudianerin; die interdisziplinär orientierte Psychoanalytikerin; der Post-Ichpsychologe; der an Fonagy orientierte Psychoanalytiker) bietet aber einen breit aufgefächerten, abwechslungsreichen, spannenden Zugang. So habe ich z.B. die Fragen des „Laien“ als erfrischend (und die Antworten darauf als sehr verständnisfördernd) erlebt. – Die fachliche Kompetenz von W. Mertens und die Präzision seines Überblicks über die psychoanalytische „Theorie-Landschaft“ sind ja (auch im SAP) gut bekannt. Ungewöhnlich finde ich immer wieder seine schriftstellerische Fähigkeit, die mich in diesem (hoffentlich: vorerst) letzten Band der Reihe „Psychoanalytische Schulen im Gespräch“ besonders beeindruckt hat.
Joel WHITEBOOK (2018): Freud. Sein Leben und Denken. (Stuttgart: Klett-Cotta)
Noch eine dringende Lese-Empfehlung! Kurz gesagt: Das ist die Freud-Biographie, auf die ich immer schon gewartet habe. Und zwar nicht deshalb, weil hier unumstößliche neue Wahrheiten verkündet würden, sondern im Gegenteil: Der Autor legt seine Perspektiven (und die Veränderungen dieser Perspektiven in den letzten Jahrzehnten) offen und reflektiert sie, – und eben das führt zu einer Grundhaltung der kritischen Nachdenklichkeit, die weite und oft überraschende Gedankenbögen ermöglicht.
Ich zitiere den Schluss der Einleitung:
„Mein Ziel ist es (…), die Beziehung zwischen Freuds Leben und seiner Arbeit unter einer spezifischen Perspektive zu schildern, nämlich mit Blick auf die beiden oben erläuterten Themen ‚Die fehlende Mutter‘ und ‚Der Bruch mit der Tradition‘. (…)
[Ich] hoffe (…), dass es mir geglückt ist, Freud ‚mit all seinem Widerspruch‘ lebendig werden zu lassen. Der Schöpfer der Psychoanalyse war nicht bloß der bürgerliche Pater familias oder der hyperrationale Mann der Wissenschaft (…). Darüber hinaus aber war er ein leidenschaftlicher, vitaler und durch und durch menschlicher Mann, der eine ungehemmte Vorstellungskraft auf beispiellose Weise mit der Fähigkeit zu messerscharfer, zupackender ‚euklidischer‘ Reflexion in sich vereinte – eine der kreativsten, faszinierendsten Gestalten der Moderne“. (a.a.O., S. 27 f.)
Einen verblüffenden Kontrast bildet dazu das Buch von
Jürgen KIND (2017): Das Tabu. Was Psychoanalytiker nicht denken dürfen, sich aber trauen sollten. (Stuttgart: Klett-Cotta)
Der reißerische Untertitel erschien mir seltsam. Und mein Misstrauen gegen den Gestus der Selbststilisierung als großer Aufklärer oder „Erlöser“, der darin mitschwingt, hat sich bei der Lektüre nicht verringert.
Eine zwiespältige Sache: Einerseits hat da ein offensichtlich äußerst belesener und fleißiger Autor eine imponierende Menge an Material gesammelt. Hat sich in die griechische Mythologie vertieft (Vorgeschichte des Ödipus etc.), zitiert unzählige Veröffentlichungen (Bücher, Briefe usw.). Auch wenn das meiste davon den interessierten LeserInnen bereits bekannt sein dürfte, ist es doch allein von der Menge her beeindruckend. Andererseits: Die Kritik an Freud und an der Entwicklung der institutionalisierten Psychoanalyse ist inhaltlich keineswegs so neu, wie der Autor das behauptet. Was mir an dem Buch tatsächlich neu vorkam, ist lediglich die „Tonart“, in der es geschrieben ist: Aus einer verbissen-apodiktischen Haltung heraus wird seitenlang penibel (und zu Recht) nachgewiesen, dass verbissen-apodiktische Haltungen auch bei Freud zu finden sind.
Das haben sich kritische PsychoanalytikerInnen allerdings tatsächlich schon vor diesem Buch zu denken getraut.
Catherine MILLOT (2017): Ein Leben mit Lacan (Wien: Passagen Verlag)
Das Buch wurde mir beim letzten Freiberg-Symposium als Beispiel bzw. als Beleg dafür empfohlen, dass es auch nicht-missbräuchliche Liebesbeziehungen zwischen Analytikern und Analysandinnen (hier: Analysantinnen) geben könne bzw. gegeben habe.
Diese Empfehlung macht mich im Nachhinein insofern ratlos, weil bei der Lektüre in mir genau der gegenteilige Eindruck entstand. Wenn eine beeindruckende, sensible, hochgebildete ältere Dame in ihrem Rückblick auf die Zeit mit Lacan solche Formulierungen gebraucht wie: „Er liebte es, mich in Griffweite zu haben“ (S. 29), oder: „Er ließ es nicht aus, meine Erziehung auch in anderen Bereichen zu vervollständigen“ (S. 38), – läuten da nur bei mir die Alarmglocken? Meine Skepsis (auch Lacan gegenüber) hat sich dadurch jedenfalls nicht verringert…
Die einzige (leise) kritische Stelle in dem Buch möchte ich zitieren, weil ich sie nicht nur für inhaltlich interessant, sondern auch für literarisch gelungen halte:
„Ich möchte nicht die Komik seiner Vorstellungen übergehen. Die Kranken waren oft unfreiwillig komisch, aber das war auch bei Lacan der Fall. Er wusste nichts von den Dingen, die die Welt wusste: die Redewendungen des Augenblicks, die Namen der Sänger oder Sportler. Er konnte einen Kranken mit derselben Ernsthaftigkeit fragen, was die ‚Formel 1‘ sei, wie er nach Erklärungen über eine delirierende Konstruktion gefragt hätte.
(…) Seine Komik hing auch mit seiner Kindlichkeit zusammen. Ich sagte ihm oft, er sei fünf Jahre alt, was Freud zufolge das Alter strahlender Intelligenz beim Kind ist, das Alter vor den Verdrängungen, die Erwachsene immer mit einer gewissen geistigen Schwäche zeichnen. Fünf Jahre, das war auch das Alter, in dem er angeblich Gott verflucht hatte. Es gab für mich nicht den Schatten eines Zweifels, dass er ein Fünfjähriger geblieben war. Diese Idee schien mir bei ihm auf nicht viel Resonanz zu stoßen. Ich habe jedoch eines Tages irgendwo gelesen, dass er während eines Mittagessens seiner Tischnachbarin anvertraut habe, dass er ein Geheimnis habe, und dieses Geheimnis sei, dass er fünf Jahre alt sei.
Ich war somit gänzlich von seiner Lehre beseelt. Ich widmete mich ihr leidenschaftlich und begeistert. (…)“ usw. (a.a.O., S. 54f.)
Ebenfalls „lacanianisch“, aber auf ganz andere Weise ist
Iris HANIKA / Edith SEIFERT (2018): Die Wette auf das Unbewusste oder Was Sie schon immer über Psychoanalyse wissen wollten (Wien: Turia + Kant)
Ein leicht zu lesendes, sehr lebendig geschriebenes Buch. Analytikerin und Analysantin berichten und reflektieren gemeinsam bzw. abwechselnd über ihre Erfahrungen in der analytischen Situation. Über manche „lacanianisch-gläubigen“ Gedankengänge von E. Seifert ließe sich gut streiten. Das ändert nichts daran, dass der Text insgesamt (und das ist hier nicht pathologisierend bzw. entwertend gemeint) erfrischend-„hysterisch“ daherkommt, – samt einigen idealisierenden Formulierungen, hinter denen immer echte Begeisterung spürbar ist.
Bei einem eher zwänglich strukturierten Leser wie mir löst das einerseits Amüsement und Sympathie aus. Andererseits gibt es mehrere (vielleicht doch irgendwie „typische“?) Schlampigkeiten oder Fehler, die mich auch irritiert haben.
So wird etwa in der Begriffserklärung von „Analysant“ (vs. „Analysand“) auf Seite 43 behauptet, „Analysand“ bedeute „in etwa der (von einem anderen) zu Analysierende“ und sei „analog zum lateinischen Gerundium“ gebildet. Schon klar, was gemeint ist; aber: es handelt sich um das Gerundiv. (Das Gerundium ist die hauptwörtliche Verwendung eines Verbs). – Naja, einerseits: natürlich nur eine Kleinigkeit. Andererseits schon witzig, dass gerade eine Lacanianerin es mit der Grammatik nicht so genau nimmt…
Oder: Auf S. 30 wird als Freud-Zitat angegeben: „Nicht nur als Therapie empfehlen wir Ihnen die Psychoanalyse, sondern um ihrer Wahrheit willen“.
Bei Freud heißt es allerdings korrekt: „[Die] Psychoanalyse begann als eine Therapie, aber nicht als Therapie wollte ich sie Ihrem Interesse empfehlen, sondern wegen ihres Wahrheitsgehalts, (…).“ (GW XV, S. 169) – Kommt der Unterschied nur mir nicht ganz unwichtig vor? – u.ä.m.
(Von der Schriftstellerin Iris HANIKA hatte ich übrigens vorher schon das – sozusagen „unanalytische“ – Buch Musik für Flughäfen [suhrkamp 2005] gekannt und geschätzt. Ich war dann verblüfft, als mir klar wurde, dass eben dieselbe Autorin auch die Co-Autorin des o.g. Buches ist.)
Didier ERIBON (2017): Der Psychoanalyse entkommen (Wien: Turia + Kant)
Darüber das nächste Mal, – kein Platz mehr!
Christian Schacht
Eribon, Didier: Der Psychoanalyse entkommen. Aus dem Französischen von Brita Pohl. Wien, Berlin (Turia + Kant) 2017. 135 Seiten.
Ein Buch, das mich mit seiner Ernsthaftigkeit und seinem rhetorischen Schwung beeindruckt hat. – Sieglinde E. Tömmel verfasste dazu der „Psyche“ (2019, Heft 1, S. 66-69) eine kluge Rezension, aus der ich zitieren will. Sie schreibt, es handle sich bei Eribons Manifest um…
„…eine leidenschaftliche und oft wütende Polemik gegen die theoretische Fassung der Psychoanalyse Lacans, aber auch gegen die Theorie und Praxis Freuds: Eribon charakterisiert die Psychoanalyse insgesamt als eine Theorie, die sich ‚als Wissenschaft präsentiert und deren begriffliches Räderwerk […] mit Mechanismen in Blockbuchstaben gespickt ist – Phallus, Kastration, Gesetz des Vater, symbolische Funktion, Bedeutungsordnung […] bei den einen, Stadien der Libidoentwicklung, Narzissmus etc. bei den anderen‘ (S. 56). Die Psychoanalyse mache es sich zu Aufgabe, ‚das gute Funktionieren der Norm‘ und die ‚Perpetuierung der psychischen und sozialen Normalität‘ sicherzustellen (ebd.). Durch die ‚verheerende Konstruktion der Ödipalität‘ werde in der Lacan’schen Fassung jede Homosexualität zur Perversion, was bei ihm zum Vorschein komme, sei ‚vulgärste, maskulinistische Ideologie‘ (S.34). (…)
Er [Eribon; Erg. C.S.] wolle keine ‚Philosophie der Liebe‘ formulieren, die das zum Ergebnis hätte, was er der Psychoanalyse vorwirft: eine ‚moralische Entscheidung zu implizieren‘, die sich auf bestimmte Beziehungserfahrungen stützt, die dann als universell dargestellt würden (S. 17). Vielmehr wolle er eine ‚Antiphilosophie‘ vorlegen, die daran arbeitet, Definitionen zu dekonstruieren. Die Psychoanalyse presse die gelebten Erfahrungen der Individuen in ein Raster, reduziere sie in einige wenige und einfache Schemata, um alles, was nicht dazu passe, herabzumindern: ‚Differenz auf den Status der Devianz, das Ereignis auf das bereits Bekannte, das nie Dagewesene auf Gestalten der Vergangenheit‘ (S. 18).“ (a.a.O., S. 67)
Dass Eribon auf Roland Barthes, Michel Foucault und Judith Butler Bezug nimmt, regt mich dazu an, mich mit deren Schriften endlich einmal genauer zu befassen. – Gegenüber Eribons Lobpreisung der „Sanftheit des Androgynen“ bin ich zwar skeptisch. Andererseits enthält z.B. die wütende Attacke der folgenden Sätze etwas, was ich nachvollziehen kann und für wichtig halte:
„Die Sanftheit des Androgynen gegen die Arroganz der Psychoanalytiker_innen, sein Lächeln gegen ihr Lachen – und gegen ihre Dogmen (Dogmen, die sich so oft, ist das aufgefallen, in Form eines hämischen Grinsens ausdrücken, dieses Grinsens, das die Gewissheit zum Ausdruck, bringt, in der Wahrheit zu sein und die Position der Überlegenheit über jene einzunehmen, über die man spricht, Kontrolle über sie zu haben: eines Tages müsste man das verzerrte Grinsen aufmerksamer untersuchen, das Psychoanalytiker_innen ständig aufsetzen und das mit einer bestimmten Stimmlage die fortgeschrittenste Form der Selbstsicherheit, der Kontrolle, die sie sich über die anderen anmaßen, und des Genießens signalisiert, das ihnen diese Kontrolle verschafft. Der Psychoanalytiker oder die Psychoanalytikerin bestimmt sich durch dieses Grinsen als das, was Nietzsche den Ressentimentmenschen genannt hätte, dessen Wille zum Wissen nur schlecht einen Willen zur Macht verhehlt).“ (Eribon 2017, S. 114f.)
Susann Heenen-Wolff: Gegen die Normativität in der Psychoanalyse. Gießen (Psychoszial-Verlag) 2018, 146 Seiten.
Ebenfalls eine sehr empfehlenswerte Lektüre! An manchen Stellen in der Zielrichtung Eribons Buch ähnlich, – aber in einem viel nachdenklicheren, nüchterneren Tonfall geschrieben. (Was mich beim ersten Lesen des Buches enttäuscht hat, war lediglich die Tatsache, dass mir drei der sechs Kapitel aus Veröffentlichungen in Zeitschriften schon bekannt waren.)
Ich versuche, die (thematisch sehr unterschiedlichen) Kapitel mit kurzen Zitaten vorzustellen.
Unter der Überschrift „Dekonstruktion vom Konzept eines universalen Ödipuskomplexes“ (S. 13 ff.) geht es um den immer noch „normativ ausgerichtete(n) Blick auf die Sexualität auch in der zeitgenössischen Psychoanalyse“ (S. 45) bzw. um die Hoffnung auf eine „zunehmende Entideologisierung, d.h. Ent-Essenzialisierung der Geschlechterdifferenz“ (S. 37) in der Psychoanalyse. – Hier ein Beispiel für die Differenziertheit, mit der sich die Autorin mit dem Thema auseinandersetzt:
„…(Wenn) wir davon ausgehen, dass menschliche Sexualität polymorph ist, dann dienen Kategorisierungen wie ‚heterosexuell‘, ‚schwul‘ und ‚lesbisch‘ den jeweiligen geronnenen Identitäten und sozialpolitischen, aktivistischen Zielen. Aus psychoanalytischer Perspektive aber ist eindeutig, dass solche Kategorien eine – notwendige, unumgängliche und letztlich strukturierende – Abwehr gegen die Plastizität von Sexualität darstellen: eine Leistung des Ichs – gegen die polymorphen potenziellen Überraschungen durch aus dem Unbewussten auftauchende Wünsche.“ (a.a.O., S. 36)
Im Kapitel „Die Falldarstellung als Mutmaßung“ (S. 59 ff.), das mich besonders interessiert hat, finden sich die Sätze:
„Das kasuistische Vorgehen in der Psychoanalyse ist wegen seiner bloßen Heuristik wissenschaftstheoretisch scharf kritisiert worden (..) In der Tat: Wir kennen die Diskrepanz zwischen Einzelfall und Kategorie, zwischen therapeutischem Prozess und Theorie, zwischen klinischer Erfahrung und Metapsychologie, zwischen wissenschaftlichem Anspruch und der unendlichen, der wissenschaftlichen Erfassung so widerspenstigen Vielfalt von psychischem Geschehen, welches durch den Fallbericht unweigerlich ‚diszipliniert‘ (…) wird. Und doch: wir haben durch Falldarstellungen viel erfahren (…).“ (a.a.O., S. 60)
Und über das Schreiben von Falldarstellungen durch AnalytikerInnen:
„Ohne Zweifel hängt von der theoretischen Orientierung ab, wie man schreibt und wovon man berichten will: Vom emotionalen Austausch? Von der Übertragung? Von der Gegenübertragung? Vom effektiv Verbalisierten? Von dem, was unausgesprochen geblieben ist? Vom Prozess? Von einem bestimmten Moment in der Analyse? Der Postbionianer legt auf anderes Wert als der Lacanianer, der Intersubjektivist schreibt anders als der Kleinianer.
Allen gemeinsam ist das Problem, mit der Ambiguität und der Polysemie von Sprache umgehen zu müssen. Die Psychoanalytikerin, gleich welcher Richtung, sieht sich der Vielfalt von Sinn und Bedeutung im Sprechen der Analysandin konfrontiert. (…)“ (a.a.O., S. 63)
Im Kapitel „Werkstattbericht aus einer freudo-lacanianischen Gruppenarbeit“ (S. 83 ff.) geht es, sehr verkürzt gesagt, um die Frage:
„Sind wir FreudianerInnen zu leichtgläubig hinsichtlich ‚früher‘ Traumen, sind die LacanianerInnen zu wenig empfindsam dafür?“ (a.a.O., S. 94)
Heenen-Wolffs differenziertes Resümee:
„Beeindruckt hat mich in dieser freudo-lacanianischen klinischen Arbeit die Warnung, dass die starke Betonung von Be- und Verarbeitungsprozessen bei den FreudianerInnen das Risiko mit sich bringt, die ‚jouissance‘ des Patienten letztlich zu unterstützen, – diese neurotische ansprüchliche Haltung, dieser ‚Fels der Kastration‘, ist in der Tat ein gewaltiger Widerstand, der Analytikerin und Analysandin gleichermaßen lähmen kann.
Dafür ist meinem Eindruck nach in der lacanianischen Lesart viel zu wenig Platz für notwendige Trauerprozesse hinsichtlich des realen oder fantasierten Objektverlustes, gerade um über eine Anspruchshaltung hinaus zu gelangen. Um solche Trauerarbeit zu realisieren, ist es vielleicht doch erleichternd, nicht allein zu sein, und für die meisten Menschen gehört dazu, von der Trauer zu sprechen und sie zu teilen – um sie zu verarbeiten!“ (S. 101)
Ein wichtiger Punkt (der auch mein Misstrauen gegenüber Lacan präzise trifft) wird mit dem Einwand formuliert, dass…
„…der Einfluss des Beobachters auf das beobachtete Objekt – entscheidende wissenschaftliche Erkenntnis der Sozialwissenschaften des 20. Jahrhunderts – von den LacanianerInnen völlig vernachlässigt wird. Die Persönlichkeit der Analytikerin, ihr psychisches Geschehen, ihre expliziten und impliziten Theorien, ihre Erfahrung – all diese Faktoren beeinflussen unweigerlich den psychoanalytischen Prozess.“ (a.a.O., S. 99)
Aus dem Kapitel „Die Position des Analytikers aus der Sicht von Laplanche“ (S. 103 ff.):
„ Nicht die analytische Situation als solche erzeugt durch ihre Einrichtung (…) Übertragung, wie es klassisch beschrieben wurde, sondern die durch kompromittierte Botschaften bestimmte Position des Analytikers. Bei Laplanche heißt es für die Position des Analytikers nicht: ‚Ich bin nicht der, den Sie glauben zu sehen, Sie verwechseln mich mit einem anderen‘, sondern eher: ‚Ich bin das Rätsel, versuchen wir es zu übersetzen‘. (…)
Laplanche unterscheidet die analytische Übertragung scharf von der allgemeinen Übertragung von Haltungen, Erwartungen, (…) so wie wir sie im Alltag beobachten können. Die analytische Übertragung kann nicht reduziert werden als bloßer Ausdruck der infantilen Neurose, als Wiederauflage von ‚patterns‘, die es aufzulösen gelte. Nach Laplanche verweist die äußere Alterität zurück auf die innere Alterität, auch die des Analytikers! Diese ursprüngliche Szene ist unauflösbar.“ (a.a.O., S. 109)
„(…) Das Ziel der Analyse definiert er [Laplanche; Erg.C.S.] so: ‚Wir hoffen lediglich, dass der Analysand etwas von der Beziehung zum Unbekannten beibehält und dies außerhalb der Analyse nutzen kann, dies ist das schönste Ergebnis von Analyse‘ (…).“ (a.a.O., S. 112)
Zuletzt eine interessante Stelle aus „Die psychoanalytische Institution – eine autoritäre Sekte?“ (a.a.O., S. 117 ff.), in der es um ein Phänomen geht, …
„..das nur selten in der Reflektion über unser Funktionieren in unseren Institutionen berücksichtigt wird: die Übertragung auf die Psychoanalyse selbst. Freud hatte gemeint: ‚In der Regel hat die Psychoanalyse den Arzt entweder ganz oder gar nicht‘ (…).
Wenn wir uns unsere (…) Aktivitäten vergegenwärtigen – Veröffentlichungen, Vorträge, Teilnahme an Tagungen und Kongressen – können wir uns fragen, ob wir nicht in dieser (Über-)besetzung der Psychoanalyse Spuren unserer alten Übertragungslieben für unsere AnalytikerInnen und unsere SupervisorInnen finden, jetzt in der Form von ‚wissenschaftlicher Übertragungsliebe‘. Die Bildung von Untergruppen innerhalb unserer analytischen Gesellschaften, von Clans, gebildet von AnalytikerInnen und ihren AnalysandInnen, SupervisorInnen und ihren SupervisandInnen können vor allem die Funktion haben, unsere alten Übertragungslieben in neuem Gewand zu schützen und zu perpetuieren. Dies hat wichtige Auswirkungen auf das Leben in der Institution.“ (a.a.O., S. 124)
Noch zwei Lese-Tipps:
Sigmund Freud: Unterdess halten wir zusammen. Briefe an die Kinder. Herausgegeben von Michael Schröter, unter Mitwirkung von Ingeborg Meyer-Palmedo und Ernst Falzeder. Berlin (Aufbau Verlag) 2011. 683 Seiten.
und
Sigmund Freud / Eugen Bleuler: „Ich bin zuversichtlich, wir erobern bald die Psychiatrie“. Briefwechsel 1904-1937. Herausgegeben von Michael Schröter. Basel (Schwabe), 2012, 287 Seiten.
Zwei wunderbare Schmöker-Bücher für Menschen, die nicht nur an der Geschichte der Psychoanalyse, sondern auch an der Person von S. Freud interessiert sind.
Beide von Michael Schröter – ganz hervorragend – herausgegeben, versehen mit knappen, informativen Kommentaren, Querverweisen usw. (Der Band mit den Briefen an die Kinder ist übrigens erstaunlich günstig um € 10,30 zu erwerben.)
– Bei nächster Gelegenheit werde ich mich dann der Lektüre der vierbändigen vollständigen Ausgabe der Brautbriefe von Martha Bernays und Sigmund Freud zuwenden. Darauf bin ich gespannt. (Laut Ernst Falzeder gibt es da einen ganz unbekannten, einen jugendlich-unbeherrschten, unsicheren, ehrgeizigen, eifersüchtigen, leidenschaftlichen Sigmund Freud zu entdecken… – Und dazu, mindestens ebenso spannend, eine noch viel unbekanntere Martha Bernays…
Herwig OBERLERCHNER
Manfred Lütz: Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? Erfahrungen eines berühmten Psychotherapeuten. Freiburg, Basel, Wien: Herder. 2020.
Manfred Lütz, Psychiater, Psychotherapeut und Theologe, Autor verschiedenster Bücher wie: „Irre! Wir behandeln die Falschen!“, launiger Vortragender bei Großveranstaltungen wie Psychiatriekongressen und Karnevalsredner fliegt im Jänner 2020 nach New York um den berühmten Psychotherapeuten Otto Kernberg zu treffen und mit ihm über Gott und die Welt zu reden. Aus den 22 Stunden Tonaufzeichnungen der Interviews ist dieses Buch hervorgegangen, in dem Kernberg über sein Verständnis von Psychotherapie, die Verhaltenstherapie, neurobiologische Konzepte, Donald Trump, seine Kindheit in Wien und seinen Werdegang redet, und das in einer Sprache, die auch der „gebildete Metzger“ (Lütz) verstehen kann. Einblicke in ein inzwischen über 90 Jahre währendes Leben und 65 Jahre Psychotherapieerfahrung.
Peter Teuschel: Neulich in der Sprechstunde. Skandalöses und Merkwürdiges aus der psychiatrischen Praxis. Stuttgart: Schattauer. 2020.
Peter Teuschel ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in München und Autor mehrerer Bücher zum Thema Ausgrenzung in Beruf und Familie (Mobbing, Bullying …). In diesem Buch, basierend auf seinem Blog „Schräglage“, gibt er tiefe Einblicke in seine langjährigen Erfahrungen als Arzt in Kliniken, seine berufliche Sozialisation und seine Arbeit als Coach. Er setzt sich kritisch mit der Diagnose Anpassungsstörung auseinander („Die dümmste Diagnose“), nimmt die Spur der Stigmatisierung in Medien auf, beschreibt Resilienz und viele weitere aktuelle Themen auf humorvolle, nachdenkliche und ironische Art. Und das in knappen, maximal fünf Seiten langen Kapitel, die als Denkanstoß vorm Einschlafen, zwischen Therapiestunden, in der Mittagspause, in öffentlichen Verkehrsmitteln gelesen werden können.
Bodo KIRCHNER
Manfred Lütz: Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? (Herder, 2020)
Manfred Lütz, Psychiater, Theologe und Autor hat Otto Kernberg interviewt und daraus ein kleines Büchlein mit ebendieser, titelgebenden Frage verfasst. Bereits auf Seite 3 bittet der Autor in der Frage des Genderns um Verständnis, dass er (Jürg Willi zitierend) „die einfache Sprache der zwar korrekten, aber unübersichtlicheren vorzieht“. Das ist vielleicht ein zentrales Motto des ganzen Buches, in dem es darum geht, etwas Unübersichtliches, nämlich das Unbewusste, die Psychoanalyse, die Psychopathologien und Psychotherapien in einfacher Sprache dem gebildeten Laien (in Lütz´scher Diktion: „dem gebildeten Metzger“) verständlich zu machen.
Die Biographie Kernbergs soll dabei helfen, sie nimmt einen nicht unerheblichen Teil des Buches ein und überrascht immer wieder mit Anekdoten, Reflexionen und durchaus kritischen Kommentaren, die Lütz offenbar auch willkommen sind. Ist er doch auch ein Skeptiker und Kritiker, der seinen Assistenzärzten angeblich verboten hat, den Begriff Narzissmus zu verwenden. Ein Narr, wer schlecht darüber denkt – Sind nicht Rede- und Denkverbote gerade ein Thema für die Psychoanalyse? Aber auch die Vertreter dieser Zunft kommen nicht immer gut dabei weg, gibt es doch genügend Schweigen über Missbrauch von Sexualität und Macht in psychoanalytischen Ausbildungsinstitutionen, wie wir von Kernberg erfahren. Freilich, nicht nur in diesen. Die Macht der alten Männer, der Psychotherapeuten und Priester wird ebendort sichtbar, wo zwei alte Männer über Unterschiede, Chancen und Grenzen der Psychotherapie und der Seelsorge reden. Im Disput über Gott wird der Interviewer Lütz dann zum Prediger, der den Atheisten Kernberg überzeugen möchte. Dieser antwortet immer wieder erstaunlich einsilbig, dann schließlich, höflich zweifelnd: „Sie haben in mir eine Frage erweckt, aber die kann ich nicht beantworten.“ (S.131).
Das Kapitel über die Psychologie des Bösen ist vielschichtig und aufschlussreich, sowohl in biographischer, als auch historischer und ethischer Hinsicht. Kernbergs Hassliebe zu Wien, seine weltweite Suche nach einer psychoanalytischen Wahrheit zwischen Wissenschaft und Emotionalität, die bisweilen ironische Distanz zu den Konflikten und Spaltungstendenzen innerhalb der Schulen und seine Kritik der Lehranalyse, der Selbstisolierung und Mystifizierung der Ausbildung durch „Autoritäten“ werden in ihren Zusammenhängen erkennbar und nachvollziehbar. Auch seine klaren differenzierten Positionen zur Geschichte im Nationalsozialismus, dem Holocaust und Antisemitismus, die Überlegungen zu Heimat und Fremde, sowie seine damit verbundenen, durchaus emotionalen und bewegenden Lebensepisoden von den 50´ern bis zum Ende des 20. Jahrhunderts sind in diesem Zusammenhang lesenswert.
Im letzten Kapitel über „Kunst und Liebe“ spricht Kernberg offen auch über (seine) Sexualität und Liebesbeziehungen, Verliebtheit, Glück und Gnade, Erotik und Ekstase. Seine Überlegungen zu gelingenden und misslingenden Paarbeziehungen sind von großem Ernst und Ehrlichkeit. Auch die Beziehungen zu seiner ersten Frau, Paulina, und seiner jetzigen, Kay, werden thematisiert und die Verbindung zu den Religionen und Zeremonien, Kunst und Literatur. Ein Streifzug durch das Leben und Denken eines großen Analytikers, der den Sinn des Lebens mit Freud teilt: „Lieben und arbeiten“.
Christian SCHACHT
Ellen REINKE: Das psychoanalytische Erstinterview und seine Bedeutung für Diagnostik und Behandlung. Gießen: Psychosozial Verlag, 2017
Ein Buch, das ich mit Genuss gelesen habe, weil es mich sowohl vom Inhalt als auch vom Stil und von der Grundhaltung her beeindruckt hat.
Die 79-jährige Autorin, Psychoanalytikerin und von 1991 bis 2007 Professorin für Psychologie an der Universität Bremen, beschäftigt sich zuerst mit der erkenntnistheoretischen Dimension des Interviews, mit den Überlegungen Ricoeurs zur Interpretation, mit dem Konzept des szenischen Verstehens nach Lorenzer, und stellt dann anhand zahlreicher, sehr anschaulich geschilderter Beispiele sowohl das Erstinterview nach Argelander als auch das strukturelle Interview nach Kernberg vor.
Ich habe das Alter der Autorin erwähnt, weil man beim Lesen merkt, dass da jemand aus jahrelanger Erfahrung schöpft und gleichzeitig hellwach geblieben ist: Unpolemisch, präzise und nachdenklich in der Darstellung unterschiedlicher psychoanalytischer Denktraditionen, souverän und unerschrocken auch im Offenlegen und Reflektieren eigener Gegenübertragungsreaktionen, – alles in einem eleganten, gut lesbaren Duktus.
Zwei (nicht ganz ernst gemeinte) Kritikpunkte habe ich anzumerken:
1) Längere Kernberg-Zitate werden nur im englischen Original wiedergegeben, ohne Übersetzung ins Deutsche. Für LeserInnen wie mich, die über Schulenglisch nicht hinausgekommen sind, ist das mühsam.
2) Anscheinend ist weder der Autorin noch dem Lektorat aufgefallen, dass sich in dem langen Verbatim-Protokoll ab Seite 235 eine Fehlleistung wiederholt:
Mehrmals steht „Freud“ statt des Wortes „Freund“. (Etwa auf Seite 257: „Also, einige Wochen lang war die sexuelle Beziehung zu Ihrem Freud befriedigend.“ – Freud, schau oba…!)
Christian Schacht
Dorothea STEINLECHNER-OBERLÄUTER (2021): „Rudolf Ekstein. Psychoanalytiker – Pädagoge – Philosoph.“ Biographi-sche Einblicke und theoretische Grundkonzepte. (Edition Tandem)
Unsere Kollegin Dorli Steinlechner-Oberläuter, Klinische Psycho-login, Schulpsychologin, Psychotherapeutin für Kinder und Jugend-liche in Salzburg, dem SAP seit Jahren als a.o. Mitglied verbunden, hat ihre Dissertation aus dem Jahr 1985 über Rudolf Ekstein (1912-2005) in einer ergänzten und überarbeiteten Auflage neu heraus-gebracht. Es ist ein unglaublich reichhaltiges Buch geworden. Am leicht lesbaren, eleganten Stil merkt man die schriftstellerische Potenz der Autorin, (wovon man sich übrigens auch schon in ihrem Buch „Mein Donauschwabien. Wie ich nicht aufhören konnte, über meine Herkunft nachzudenken“, Edition Tandem, Salzburg 2018, überzeugen konnte).
- Ekstein, im Wien der Zwischenkriegszeit aufgewachsen, war als jüdischer, im Widerstand tätiger Psychoanalytiker 1938 in die USA emigriert und entwickelte dort sein vielfältiges Werk. Dorli Steinlechner-Oberläuter setzt sich damit auf sehr differenzierte, präzise Weise auseinander. W. Datler und J. Gstach geben dem Buch eine informative Einleitung. Auf das spannende, prägnante Nachwort der Autorin möchte ich besonders hinweisen.
P.S.: Auf der Homepage der Edition Tandem ist ein Interview abrufbar (unter: https://www.edition-tandem.at/video-rudolf-ekstein-psychoanalytiker-paedagoge-philosoph/), das ich mit der Autorin im Mai 2021 geführt habe. (Ist auch auf youtube zu finden, unter tandem-tratsch, steinlechner-oberläuter, ekstein…etc.)
Prim. Mag. Dr. Herwig Oberlerchner; MAS
Im Namen von Wissenschaft und Kindeswohl
Prim. Univ. Prof. Dr. Franz Wurst wurde im Jahr 2000 wegen Anstiftung zum Mord an seiner Ehefrau verhaftet. Im Zuge der Ermittlungen trat sexualisierte, physische, psychische und strukturelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen in Kärntner Institutionen – Gerüchte gab es zuvor bereits über Jahre – in einem nicht vermuteten Ausmaß zu Tage. Bis zum Jahre 2002 gingen 38 Meldungen an die Opferschutzkommission ein. Schon damals war klar, dass Art und Ausmaß der Gewalt und die Dunkelziffer wesentlich größer sein dürften. Im Jahr 2018 waren bereits 124 Opfer von der Opferschutzkommission anerkannt.
Um allfällige strukturelle Hintergründe zu beforschen, wurde schließlich auf Anregung der Kinder- und Jugendanwältin des Landes Kärnten Frau Astrid Liebhauser eine wissenschaftliche Aufarbeitung initiiert – der Forschungsauftrag erging an die Alpe-Adria-Universität Klagenfurt. Neben Privatpersonen und verschiedenen Institutionen beteiligten sich auch die Ärztekammer Kärnten und die KABEG an der Finanzierung.
Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes – Zwischenergebnisse wurden mehrfach veröffentlicht – liegen nun in Buchform vor und geben einen düsteren und betroffen machenden Einblick in die Geschehnisse in der Zeit von 1950 bis 2000, als Franz Wurst die Heilpädagogische Abteilung leitete, heilpädagogische Gutachten verfasste, Lehrender an Akademien und Universitäten und Konsiliararzt im Jugendheim in Görtschach war und auch eine Privatordination führte.
Neben der Darstellung des Forschungsdesigns, der Beschreibung der betroffenen Institutionen und des historischen Kontextes bilden das Kernstück dieses Buches aber die Stimmen der Opfer, die ihrem schier unglaublichen Leid, ihrer Ohnmacht und Hilflosigkeit Ausdruck verleihen. Kinder und Jugendliche waren schutzlos einem Netzwerk des Grauens ausgeliefert, ihre Erzählungen über die erlittene Gewalt in verschiedensten Facetten wurden nicht ernst genommen, ihre reaktiv entstandenen Verhaltensweisen als Ausdruck psychischer Erkrankung missinterpretiert. Auch wenn im Zentrum dieser Ereignisse die Person Franz Wurst stand, wurde im Rahmen der Forschungsarbeit bald klar, dass Kontrollbehörden, politische Verantwortungsträger, aber auch jene Institutionen selbst, die eigentlich für Behandlung, Erziehung und Pflege zuständig waren, in ihrer Funktion völlig versagten (Systemversagen), und diese Gewalt nur in einem Kontext von Ignoranz, Verschweigen und Verleugnen, Mittäterschaft und Wegschauen entstehen konnte.
Besonders betroffen macht die Erkenntnis, dass es einen Zusammenhang zwischen den rassenhygienischen und erbbiologischen, auch aus der Ära des Nationalsozialismus stammenden menschenverachtenden Ideologien und dem (pseudo-)wissenschaftlichen Fundament der Ära Wurst eingebettet in eine „totale Institutionalisierung“ gibt.
Diverse Veröffentlichungen, eine Geste der Verantwortung der Kärntner Landesregierung am 30.1.2020, ein Symposium, Vorträge und andere Aktivitäten bilden nun mit dieser umfassenden Darstellung der Geschehnisse in Buchform Mosaiksteine einer Gedenkkultur, deren Ziel es ist, das Unrecht zu benennen, Verantwortung zu übernehmen und die Opfer zu hören.
Loch Ulrike, Elvisa Imsirovic, Judith Arztmann, Ingrid Lippitz: Im Namen von Wissenschaft und Kindeswohl. Gewalt an Kindern und Jugendlichen in heilpädagogischen Institutionen der Jugendwohlfahrt und des Gesundheitswesens in Kärnten zwischen 1950 und 2000. Studienverlag: Innsbruck, Wien. 2022.
Christian Schacht
Gerhard ZENATY: „Sigmund Freud lesen. Eine zeitgemäße
Re-Lektüre“ transcript Verlag, Bielefeld 2022
Ich habe – jedenfalls auf psychoanalytischem Gebiet – seit Joel Whitebooks „Freud. Sein Leben und Denken“ kein Buch mit so großem Interesse und mit solchem Genuss gelesen wie dieses. Es ist nicht nur klug gegliedert, es macht nicht nur präzise und fundiert auf manche (auch für Insider) überraschende Aspekte und Widersprüche in der Entwicklung von Freuds Denken aufmerksam. Das alleine würde ja schon ausreichen, um die Lektüre zu empfehlen.
Es kommt etwas Wichtiges hinzu, was in anspruchsvoller Fachliteratur keineswegs selbstverständlich ist: Es ist wunderbar geschrieben! Stilistisch elegant, gut nachvollziehbar, immer verständlich. (Ist die Hypothese gewagt, dass die jahrzehntelange intensive Beschäftigung mit Texten Freuds auf den Autor hier möglicherweise irgendwie „abgefärbt“ haben könnte? Der Gedanken kam mir speziell bei jenen Passagen, wo Zenaty – darin Freud stilistisch durchaus ähnlich – einen Absatz z.B. mit einer geschickten rhetorischen Frage einleitet. Ein zum Mitdenken einladender, leser:innenfreundlicher Tonfall durchzieht sozusagen das ganze Buch.)
Als kleines Beispiel dafür, in welch respektvoll-kritischer Haltung sich Zenaty mit dem Werk von S. Freud auseinandersetzt, bringe ich eine Stelle auf Seite 110. Sie beginnt mit dem Satz:
„[…] Im folgenden Abschnitt versucht Freud die unterschiedlichen Entwicklungsprozesse bei Frau und Mann zu erklären.“
Dazu heißt es in einer Fußnote:
„Es ist wohl in erster Linie dieser Abschnitt, der in der analytischen community schon zu Freuds Zeiten und bis heute die schärfste Kritik erfahren hat. Dies wohl primär deshalb, weil Freud hier seinen Anspruch, seine Theorie des Sexuellen von kulturellen Normen frei zu halten, über weite Strecken verloren hat.“
Dann heißt es weiter im Text:
„Diese Unterschiedlichkeit beginnt – so Freud – schon in der frühen Kindheit. Er nimmt an, dass beim Mädchen die Sexualhemmungen (Scham- und Ekelschwelle etc.) früh-zeitiger und heftiger ausgebildet werden: ‚[…] die Neigung zur Sexualverdrängung erscheint überhaupt größer; wo sich Partialtriebe der Sexualität bemerkbar machen, bevorzugen sie die passive Form‘ […]“
Dazu heißt es wiederum in einer Fußnote:
„Dass Freud diese Phänomene an seinen Patientinnen ‚richtig‘ beobachtet hat, steht wohl außer Zweifel. Er hat allerdings die auch kulturell geprägten Geschlechterverhältnisse seiner Zeit immer wieder unbemerkt ontologisiert.“
Auf die Aufzählung weiterer ähnlich prägnanter Beispiele muss hier verzichtet werden. Kurz: Für mich war es eine äußerst lohnende, spannende Lektüre.
– Große Leseempfehlung!
P.S.: Vgl. dazu auch eine von Konrad Paul Lissmann verfasste Rezension im STANDARD vom 14.5.2022, abrufbar unter:
https://www.pressreader.com/austria/der-standard/20220514/282437057718625